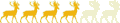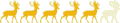- Registriert
- 21 Jul 2006
- Beiträge
- 570
Mag sein, daß ihr nach der Lektüre sagt: "Jetzt ist er völlig verrückt geworden."
Sei's drum. Mir war es wichtig, diese Geschichte zu schreiben.
Eine Freundin
Blassblau der Himmel, wie er halt im englischen Frühling so ist. Auf meinem Erdsitz hinter dem toten Pappelstamm, dessen Zwilling in meinem Rücken wuchs und mit hängenden Zweigen um seinen gefallenen Bruder trauerte – die Wunde, die dessen Tod ihm gerissen, war an den Rändern schon mit Rindenschorf umfasst und heilende Algen hatten sich auf das blanke Holz darin gelegt – hatte ich mich recht behaglich eingerichtet und genoss diesen Abend aus vollem Herzen.
Die letzten Tage war das Wetter wenig charmant gewesen, und als ich aus London ins Juwelenrevier gereist war, hatte das Thermometer meines Cabriolets vielleicht sieben oder acht Grad gewiesen. Mir war nichts weiter drum: ich hatte die bleierne Luft des 8-Millionen-Molochs lange Wochen ohne Pause meine Lungen peinigen lassen. Kaum hatte ich bei Oxford die Autobahn verlassen, kaum hatte ich die Universitätsstadt durchquert, hatte ich das Automobil an den Straßenrand gesteuert, das Dach geöffnet, mich in die warme Tweedjacke gehüllt und war unter einem zwar kalten, aber freundlichen Himmel offen weiter gefahren. Freund Georges empfing mich breit grinsend vor dem Manor, und lachte mit schwerem Akzent die Worte hervor: „Frische Luft und kaltes Wasser sind gesund für junge Männer!“
Ja, er hatte recht. Den Winter über hatte ich vor mich hin gekränkelt, eine schwere Erkältung hatte mich gepackt und über viele Wochen nicht aus den Klauen gelassen – selbst das geliebte Tabaksrauchen hatte ich darob aufgegeben. Aber jetzt, nach der Fahrt über Land in kalter, klarer Luft auf kleinen, engen und winkeligen Sträßchen, entlang hoher Hecken und hinter steinernen Mauern herum, an alten Höfen vorbei und durch pittoreske Dörfer, in denen der kleine Bach, der den Anwohnern früher als Waschgelegenheit für Alltags- und Sonntagssaat gedient hatte, nicht über steinernen Brückenbogen, sondern in ziegelsteingepflasterter Furt zu überque3ren war, wo der Kirchturm, Steeple im Englischen so weithin über Land leuchtete, dass er den Landedelleuten als Ziel eines scharfen Rittes diente um die Wette einer Flasche feinen Weines oder um den Kuss einer schönen Frau, die am Ende dieser Kirchturmjagd, dieser steeple chase stand und der von Lebenslust und Reiterglück erhitzten Burschen harrte – diese Fahrt hatte auch von mir jede Spur von Stadt und Krankheit fortgeblasen. Mit heißrotglühenden Wangen war ich aus dem Wagen gesprungen und hatte auf Georges Worte froh gerufen: „At least one useful thing England gave us in exchange for our Hannoverian kings!“ Wenigstens diese eine löbliche Einrichtung körperlicher Abhärtung und Ertüchtigung durch klare Luft und kaltes Wasser hatte Deutschland erhalten dafür, dass es aus dem Hause Hannover vom ersten Georg bis zur großen Viktoria immerhin sechs gekrönte Häupter bekommen hatte – und die schlechtesten waren es nicht gewesen!
Samstag war es, Mittag war es, und vor mir lag eine frühe Maiwoche an einem der schönsten Orte dieser Welt, nur der Jagd und langen Geschichten vorbehalten. Doch kaum hatte ich mein Gepäck im Gartenzimmer verstaut, meine Kippläufige zusammengesetzt, Stadtfrack gegen Jagdzeug vertauscht, kaum war ich fertig zu großen Taten vors Haustor getreten, zogen von Westen, von den Commons her dunkle Wolken übers Haus, warf aufkommender Sturm Nebelfetzen über den Dachfirst, fielen Baro- und Thermometer um etliche Einheiten. Ja, so ekelhaft wurde das Wetter, dass wir dem Wilde sicheren Schirm und Schutz wünschten und uns ins nahe Cirencester verfügten um beim dortigen Jagdausstatter meine doch zu sehr auf den an sich positiven Wetterbericht gebaute Ausrüstung hinsichtlich der Kriterien „Warm“ und „Wasserdicht“ zu vervollständigen. Denn hatte ich auch noch nicht gelernt, dass britische Meteorologen vom Wetter grad ebensoviel verstehen wie ihre deutschen Kollegen – nämlich nichts –, so wusste ich doch so viel: was der Wind an frischem Unbill über Wontley Farm heran treibt, das bleibt zumindest für drei Tage in unserem Tal von River Coln und Beesmoor Brook hängen. Und grad so kam es auch.
Es war kaltes und nasses Jagen. Mochte das neue Gewand auch noch so dicht und gut sein: nach kurzem Gang durch die Wiesen wogen die Hosen bleierne Pfunde, und schloff ich durch eine Hecke, dann schütteten mir Weißdorn und Hagdorn noch ähnliches Gewicht auf die Schultern. Nach jedem Gang schrie die Büchse nach frischem Öl, und die Jacke wollte in der recht englisch klammkalten Halle des Hauses nie trocknen. Wahrhaftig hatte ich Albion in den Jahren zuvor anders kennengelernt: wann immer ich aus Deutschland nach Charlton Abbotts gereist gekommen war, strafte das Wetter jegliches kontinentale Vorurteil über die generelle Schlechtigkeit der meteorologischen Gegebenheiten auf den Inseln Lügen. Auch der erste Sommer nach der Übersiedelung ins Königreich war so heiß gewesen, wie man ihn sich nur hätte wünschen mögen. Doch mit dem September des ersten Jahres als loyal subject to Her Majesty The Queen hatte es nur herzlich wenige Tage gegeben, an denen der Himmel nicht bittere Zähren vergossen hätte – wahrscheinlich über Ihrer Majestät Regierung unter dem angeblich recht ehrenwertem Tony Blair schändliches Gehabe! Der Jagderfolg in diesen Maitagen war dementsprechend: zwar fährtete sich das Rehwild überreichlich im nassen Boden, aber zu Gesicht bekamen wir kaum mehr als nichts. Georges hatte durch glücklichen Zufall zumindest einen Jahrling in die Wildkammer hängen können, aber meine Patronentasche hatte bislang noch das gleiche Gewicht, das sie auch bei meiner Abreise aus London gehabt hatte. Entschädigt hatte mich nur der Anblick zweier hochrespektabel veranlagter Böcke im adoleszenten Alter – und halt der innere Friede, den das – auch erfolglose – Pürschen aus der freien Hand im freien Land mit sich bringt.
Aber nichts währt ewig, auch nicht das schlechteste Wetter. Und so grüßte mich, als ich im frühen Licht des vierten Morgens vors Haustor trat, ein Himmel, aus dessen grauen Schleiern erste blaue Flecken lächelten, und die Ränder darum waren rosenfarben überhaucht. Und in den Wiesen südlich von Hank’s Gorse war ein schwacher Gabler von meiner Kugel gefallen und hatte einen weißblühenden Schlehenzweig als ortsgerechten letzten Bissen in den Äser erhalten. So saß ich denn – endlich ohne schweres Zeug am Leib – recht froh und zufrieden in meinem Erdsitz hinter dem Pappelstamm, der dem Ort den Namen „Fallen Tree“ gegeben hatte. Glas und Spektiv lagen auf dem Sitzbrett zu meiner Linken, die Büchse lehnte vor mir am Pfosten. Auf meinen Schoß lag ein Buch von Harry Paget Flashmans haarsträubenden Abenteuern und heißen Amouretten zu Zeiten des Sepoy-Aufstandes, und alle paar Zeilen guckte ich über die Wiesen hinweg, die Richtung Goretex Gully abfielen. Lang regte sich nichts, erst nach drei Viertelstunden zog weit im Osten ein einzelnes Reh den Hang herauf: mochte wohl ein Jahrling sein, trug auf seinem Haupt links eine etwas über lauscherhohe Gabel und rechts eine sichtlich auf halber Höhe abgebrochene Stange, war aber groß an Bau und stark im Wildbret, und so blieb die Büchse wo sie war und ich freute mich an seinem Anblick – auch wenn ich still rechnete, wann sich meine heutige Zurückhaltung in besserer Ernte hätte lohnen mögen. Ich sah ihm lange zu, wie er sich durch die Wiese äste und dann durch die Hecke in Richtung des nachbarlichen Winterweizens empfahl. Als er fort war, blieb die Wiese lange Zeit ruhig – wenn man einmal von den zahlreichen immer noch balzenden Fasanen absah, deren kupferrote Brust und stahlgrüner Federhelm allenthalben aus dem Halmenmeer strahlte. Dazu noch einige vier oder fünf Hasen, die auf schon dem Urgroßvater Blume altbekannten Pass ausliefen: an Niederwild gab’s hier keinen nennenswerten Mangel. Ich fläzte gemütlich in meinem Bodensitzel vor mich hin, delektierte mich am Schauspiel und ließ den Herrgott einen recht guten Mann sein. Und wie ich so meine Blicke hinüber und her übers Gras schweifen ließ, war da etwas, das in die Farbsymphonie und generelle Stimmung nicht so recht hineingehörte.
Das war ein anderer Ton, warm und leuchtend wohl, aber härter, straffer, weniger weich. Ich brauchte meine paar Minuten, bis ich den Flecken hatte, auf dem der störende Ton lag. Rot schimmerte es durch die Grashalme. Aber das war nicht das Rot eines Rehs, das um diese Jahreszeit und bei obwaltender Witterung ohnehin noch eher grau wäre. Das war satter, tiefer, kräftiger im Ton. Ich nahm mein Glas hoch und entdeckte über dem roten Halbrund rechts ein schwarzes Dreieck – aber da, wo links sein Pendant hätte sitzen müssen, da war nur ein dicker, schwarzer Strich. Ganz schlau wurde ich daraus nicht. Ich holte das Spektiv aus der Tasche, visierte die Stelle an und zog das Bild langsam scharf. Mir ist dieses Scharfziehen in der Wildbeobachtung immer einer der spannendsten Momente: erst ist da nur ein verschwommenes Farbenmeer, dann wird der eine, anvisierte Punkt schemenhaft sichtbar. Und langsam steigt die Schärfe vom Vordergrund her immer tiefer ins Bild, bis endlich das Objekt zum Greifen nah und klar ersichtlich vor dem Auge steht. So auch jetzt: der rote Fleck im Grün nahm langsam Formen an, die ersten Grashalme waren schon deutlich zu erkennen, jetzt stand die Schärfenebene nur noch Millimeter vor dem Wild, und dann – als höbe sich ein Schleier – erkannte ich hinter den Halmen einen Fuchs, der unverwandt auf eine Stelle im Grase vor sich hinstarrte. Klapperdürr war die Fee, und wahrscheinlich hockte in ihrem Bau ein Geheck ewig hungriger Mäuler, die andauernd gestopft sein wollten. Es musste schon ein besonders großes Nest besonders saftiger Mäuse sein, die da vor ihr in der Wiese herumspielten, denn sie zog lange, glitzernde Geschmacksfäden. Beständig und mit rascher, fast ruckhafter Bewegung wandte sie ihr Haupt hin und her, hielt es bald schräg, bald grade, lauschte ihrer Beute nach, sog mit bebender Nase Wind ein, streckte das Haupt dann grade und wagrecht nach vorne, und mit blitzschnellem hohem Sprung war sie in der Wiese verschwunden, präzise mit dem Fang auf ihrer Beute landend. Ein paar zitternde Halme nur verrieten das kleine Drama – die Auslöschung einer ganzen, möglicherweise altehrwürdigen Mäusesippe – das sich da auf dem Wiesengrund abspielte. Dann war Stille.
Ein weniges später sah ich die Fee wieder, als sie mit einem fang voller Mäuse auf der ausgewalzten Fahrspur in der Wiese entlang schnürte. Sie war wirklich bemitleidenswert dürr und dünn: die Flanken eingefallen, das Fell struppig, die Lunte war schier mehr nur ein dünner Quast. Ihre Brut setzte ihr offensichtlich heftig zu und ließ ihr weder Ruh noch Fraß. Der Hunger stand ihr ins Gesicht geschrieben, als sie sich in der Fahrspur auf ihre abgemagerten Keulen niederließ um ein wenig zu rasten. Und hatte sie auch den Fang voller frischer, saftigre Mäuse, ließ ihr die Gier das helle Wasser aus dem Maul triefen: keine einzige Maus verschlang sie, mochte ihr Magen auch noch so sehr danach verlangen. Den ganzen Fang trug sie in das überwucherte Tal unterhalb der Wiese, worin ihr Bau lag und ihre Welpen der sättigenden Heimkehr der Frau Mama Ermelyne harrten, dort, auf Malepartus’ lehmigen Zinnen.
Der Abend verlief ohne weitere große Zwischenfälle – doch: ein mehr als sauberer junger Bock zeigte sich auf jener Wiese, die die jenseitige, nördliche Flanke des kleinen, verwucherten Tals – Goretex Gully geheißen - begrenzte. Zweie mochte er sein, Dreie eventuell und prahlte ganz unerträglich herüber zu mir mit dicken Stange, guter Verreckung und obszöner Höhe. Der mochte wohl und gut uralt werden, denn auf dieser Wiese war keinem Bock beizukommen. Aus Goretex Gully heraus war nichts zu wollen. Man hätte schon ein Eichkatzel sein müssen, um geräuschlos durch dieses Dickert zu kommen. Aber einen Pürschsteig dort drin freizuschneiden dazu hatte ich mich nie durchringen mögen: dieses Tal war ein völlig ungestörter, ja: unstörbarer Einstand für das Wild, und den konnte und wollte ich nicht angreifen. Von Norden her, vom alten, verfallenen Gebäude der Middle Barn, war es ein zwar schwieriges, aber machbares Herankommen. Durch einen schottrigen Hohlweg kam man von unten her, aus Westwood Valley herauf. Man musste sich den Hang zwar lautlos herauf stehen, aber das hätte sich noch hindeichseln lassen. Aber war man dann an der Wiese angelangt, war sie so verflixt kupiert und in sich überriegelnd, dass man das Wild kaum in Anblick bekommen mochte – es sei denn auf fünf oder weniger Schritt. Der Schuss von der anderen Talseite, von Fallen Tree aus, wäre unter zweihundertdreißig Metern ohnehin nicht zu machen, und das geben meine Büchsenkünste vielleicht, aber mein Schießwille nimmer er. Einen Hochstand in die Weise zu pflanzen, wie es Freund Georges immer wieder empfohlen hatte, das widerstrebt meinem Fairnessdenken.
An diesem Abend beschloss ich für mich, das Sanctuarium des Goretex Gully auf die Wiese unterhalb Middle Barn auszudehnen: da wie dort sollte das Wild fortan vor mir sicher sein und sich des Lebens in Gottes freier Natur erfreuen. Sollte mir ein Bock aber auf den Wiesen außerhalb dieses Bereiches begegnen, so wäre er – Alter und Abschussrichtigkeit vorausgesetzt – meiner Kugel frei. Ich muss nun dazu sagen, dass auf den Wiesen rund um das kleine Tal von Goretex jährlich etwelche Böcke fielen. Und so waren es immer die Schwachen und die Jungen, die ich dort erlegte. Was aber die größte Freude war für mich in all dem: auch die Gäste hielten sich an diese Regelungen. In all den Jahren seit diesem Entschluss ist im weiteren Umfeld des Goretex Gully nur ein besserer Bock gefallen, und die Umstände seiner Erlegung rechtfertigen in meinen Augen einen kleinen Abschweif vom eigentlichen Thema dieser Erzählung.
Es war auf einer guten Saujagd im Bayrischen. Der Hohe Jagdherr dort hält ehern mit der guten Sitte, in jedem Gästezimmer eine Liste der geladenen Schützen auszulegen. Natürlich war mein erster Griff auf dem Zimmer nach diesem Papier, und zu meiner großen Freude las ich dort nicht nur den Namen des Mannes meiner Schwester, sondern auch den des Sohnes dazu, meines Neffen. Mangels eigener Sprösslinge sind nun meine Geschwisterkinder die jenigen, denen ich jagdliche Förderung anbieten kann, und da mein Neffe Franz die gesamte Jagdpassion seiner väterlichen Familie geerbt hat und diese so grade zu erwachen begann, lud ich Sohn und Vater nach England ein fürs folgende Frühjahr. Er lag konvenierend in just der Woche, die ich für den Jahrlingsabschuss in England eingeplant hatte. Die ersten Tage verwandte ich vor allem darauf, für meinen Neffen einen passenden Erstlingsbock auszumachen und wandte mich dafür in die wildreichste Ecke des Reviers, jene vier beieinander liegenden großen Wiesen im Bereich von Westwood, die Georges und ich gemeinsam die „Deer Larders“, also Wildkammern getauft hatten. Da trieb sich erwartungsgemäß allerhand herum, unter anderem auch ein sichtlich alter und reifer Bock mit hochspannendem G’wichtl: links eine hochbrave Sechserstange, gut eine Handbreit über die Lauscher hinaus, rechts aber eine tief gegabelte Stange von etwas geringerer Höhe, aber an der Basis gleicher Masse wie die andere. Ich dachte zuerst an eine Bastverletzung, aber mit starkem Spektiv und ruhiger Auflage konnte ich keinerlei Perlenwucherung oder sonstige verletzungsbedingte Anzeichen feststellen. Der wäre für meinen Schwager grad der Rechte gewesen, wenn er halt nur nicht seinen Ausgang just auf der lebensversichernden Wiese zwischen Goretex Gully und Middle Barn gehabt hätte. Ich machte mir im Geiste eine Notiz und suchte weiter nach einem Neffenbock. Ich fand ihn in Form und Gestalt eines jammerschwachen Knopfers, der tagtäglich und pünktlich immer zur gleichen Stunde am obersten Spitzel von Goretex Gully in der Wiese stand, stets in Begleitung eines braven Zweijährigen. Allerdings war da weit und breit kein Sitz zu finden, und so wie der Bock stand, war auch keiner sinnvoll zu bauen. Man konnte aber recht gut an die Stelle hinpürschen und – ging man leise und vorsichtig genug – auf knappe vierzig Schritt an den Jahrling herankommen. Diese Distanz hielt ich für meinen Neffen für vertretbar zum Schuss über das stabile Dreibein. Und letztlich war’s mir auch darum, dem jungen Jäger keine mühelose Erlegung aus dem bequemen Sitz heraus zu bieten, sondern spannendes und nicht ganz einfaches Jagern und Indianern.
Ich holte Schwager Alexander und Neffe Franz in Heathrow ab und – oh Wunder – alle Gepäckstücke und Waffen kamen unversehrt, vollzählig und frühzeitig auf dem Gepäckband daher (wer die britischen Flughäfen kennt, weiß, dass das nicht die Norm ist). Wir kamen so rechtzeitig in Charlton Abbots an, dass noch genug Zeit war um Franz mit meiner Kipplaufbüchse ein paar Probeschüsse über Sandsack und Dreibein machen zu lassen. Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Die Abendpürsch ebenfalls- auch wenn sie keine Strecke brachte. Aber Franz und ich hatten im warmen Abendlicht dieses frühen Maitages eine prachtvolle Indianerpürsch hingelegt.
Von Fallen Tree her waren wir durch die Hecken gekommen, und richtig hatte der Jahrling samt seinem Erzieher zu erwarteter Zeit am erwarteten Ort gestanden: gemütlich ästen die beiden auf der anderen Seite des letzten Ausläufers von Goretext Gully herum. Das Tal kommt hier den Hang herauf und endet in einem langen, seichten Graben, die nur zum Drittel noch bewachsen ist. Genau dieser Bewuchs gab uns genug Deckung um bei gutem Wind langsam und leise heran zu kommen. Franz pürschte besser und leiser als so mancher hoch erfahrene, mit Bockmedaillen reich dekorierte Gast, den ich geführt hatte. So kamen wir recht rasch und sicher ans Tal heran. Die beiden Böcke, die ich durch die Hagdorn-Buschen im Tal gut sehen konnte, hatten kein einziges Mal aufgeworfen. Allerdings begann der kitzlige Teil der Pürsch erst jetzt, als wir am Graben angelangt waren. Von hier aus war das wild auf der anderen Seite nicht mehr zu sehen, dafür waren wir herzlich nah dran: vom Wild trennten uns noch der bewachsene Graben und vielleicht fünfzig Schritt Distanz, und wären wir endlich an der Lücke angekommen, durch die der Schuss gehen sollte, wären wir noch dreißig Schritt von den beiden Böcken entfernt. Da ist der Erfolg nur in tiefster Gangart und mit der Bewegungsgeschwindigkeit eines Minutenzeigers zu suchen. Diese paar Meter, die wir zwei da entlang getigert sind, diese wenigen Meter machen eine der schönsten Pürschen meines Lebens aus: angespanntes, jeden Schritt, jede Bewegung völlig kontrollierendes, atemraubendes, aufregendes Jagen auf kleinstem Raum war das, und jedes Mal, wenn ich hinter mich sah, blickte ich in ein vor Aufregung und Leben strahlendes Bubengesicht. Es gibt Jagderlebnisse, die sich nicht um Schuss und Tod und Trophäen drehen, aber dafür schwerer wiegen als die goldenste aller hohen Medaillen. Das war ein solches, und diese Tage sollten noch mehr und reichere derartige Erlebnisse bieten. Wir kamen ungehört und ungesehen an die Schusslücke heran, aber von unseren beiden Böcken sah ich nur noch einen Spiegel gemessenen und vertrauten Schrittes im Dickicht von Goretex Gully verschwinden. Es hatte nicht sollen sein.
Wir versuchten meines Neffen Glück am nächsten frühen Morgen an anderer Stelle, und von einem Bodensitz unterhalb einer verkrauteten Wand schoss Franz sein erstes Stück Wild, einen Fuchsrüden, der durchs taunasse Gras dahergeschnürt kam. Fast hätte es zu einem Muntjak-Böckchen gelangt, aber als Franz den Stecher gehen ließ, sagte das Gewehr lediglich „Klack!“. Der junge Schütze hatte alles richtig gemacht, inklusive Lösen der Sicherung. Nur hatte ihm sein tepperter Onkel eine ungeladene Büchse gereicht! Während ich mit einem wenig intelligenten Gesichtsausdruck in den Cotswolds stand und mein Schwager sich das Lachen nur mühsam verbeißen mochte, kam’s vom Neffen: „Dürfte ich jetzt bitte eine Patrone haben? Da vorn ist ein Fuchs!“. Heute hängt besagter Fuchs in seinem Zimmer: ein in der Nähe von Charlton Abbots lebender Taxidermist hat Haupt und Vorschlag des Rüden in alter viktorianischer Manier mit aufgerissenem Rachen und gefletschten Fängen gar wunderbar präpariert, und zu Weihnachten ging ein entsprechendes Paket an den Schützen. In dem Paket lag aber noch ein weiteres Haupt, und von dessen Erlegung will ich kurz berichten.
Zur Abendpürsch wollten wir noch einmal nach dem Knopfer an Goretex Gully sehen. Der Wind hatte gedreht, und so packten wir die Sache diesmal von Norden her an. Der Weg führte uns mitten durch die Deer Larders, und als wir arglos, ungedeckt und unjagdlich laut miteinander schwatzend mitten auf der Wiese standen, sah ich an der Hecke, die Larder eins von Larder Zwei trennt ein Reh im Gras niedergetan. Der Blick durchs zehnfache Pürschglas ließ es mir siedheiß durch den Leib fahren: das war eben der Abnorme, den ich im Geiste für meinen Schwager vorgemerkt hatte! Recht weit von seinem Einstand saß er da im Schatten der Hecke und drückte behaglich das frischgeäste junge Grün der Wiesen nach. Allerdings war er nicht nur recht weit von seinem Einstand, sondern auch recht weit von uns weg, und obendrein würde der Schuss auf ihn mit Sicherheit den Knopfer, der wenn, dann in der nächsten Wiese stand, für diesen Abend nachhaltig vertreiben. Ich schilderte meinen beiden Jägern die Situation. Mein Neffe überlegte keine Sekunde: „Natürlich schießt der Papi den Bock! Den Knöpfler probieren wir dann morgen.“
Im Gesicht meines Schwagers war eine interessante Mischung aus väterlicher Rührung, Stolz, Jagdpassion und Verlegenheit zu sehen: dass sein Sohn eine Chance auf seinen ersten Bock dreingab, das rührte ihn an. Dass er den Abnormen wollte, das war ebenfalls deutlich. Aber der Schuss da hinüber war junge 150 Meter weit. Ans Schieße übers Dreibein war er von Namibia und Südafrika her gewohnt, aber vor solchem Publikum und in solcher Situation kommt unweigerlich die Angst vor der Blamage auf. Er schenkte mir einen schicksalsergebenen Blick und nahm seinen Stutzen von der Schulter. Ich richtete ihm das Dreibein auf, der Abnorme erhob sich, bekam keine Sekunde später die Kugel und begab sich krummen Rückens der Szenerie. Der Schuss saß weich.
In der Situation gab es wenig Zeit zu verwarten: der Bock war durch die Hecke vor uns geschloffen, und es stand anzunehmen, dass er über die nächste Wiese in seinen Einstand in Goretex Gully flüchten würde. Und ihn dort herauszusuchen, das wäre ein schindiges Stück Arbeit mit wenig Aussicht auf Erfolg in diesem undurchdringlichen Dornendschungel gewesen. „Lauf vor zur Hecke und schau, ob Du ihn auf der Wiese noch erwischt!“ Alexander packte die Waffe im Schwerpunkt und rannte los. Franz sah mich an: „Wenn er will, kann er ja schon ganz schön schnell laufen, der Papi.“
Nach mehreren Minuten krachte ein erneuter Schuss, wenig später kam Alexander wieder durch die Hecke und zu uns herunter: er hatte den Bock noch einmal an einer Hecke gesehen, aus freier Hand hingeschossen, das Wild sei daraufhin in der Hecke verschwunden. Getroffen habe er nicht, da sei er sich sicher. Ich ließ mir die Stelle genauer bezeichnen und wusste: weit würde der Bock nicht gekommen sein. Wir gingen selbdritt in die nächste Wiese hinein, mein Schwager zeigte mir von fern die Stelle, an der er den Bock beschossen hatte. Der Bock hatte sich just die Lücke ausgesucht, in der noch ein Stück festen Schafzaunes stand! Nach wenigen Schritten schon sahen wir das Wild im Gras liegen, der Bock war verendet. Die Krone war so, wie ich sie im Spektiv angesprochen hatte, und die rechte, abnorme, tief gegabelte Stange zeigt tatsächlich die Anlage echter Dreistangigkeit: bis zur Rose hinunter sieht man, dass da eigentlich zwei Stangen an der Basis zu einer verschmolzen sind und sich alsbald wieder voneinander trennen. In meinem Bildarchiv findet sich ein Photo von der Strecke dieses Bockes, Vater und Sohn sitzen daneben, und der Sohn strahlt fast mehr als der Vater. Mir selbst war die Erlegung doppelte Freude: zum einen freute mich das Waidmanns Heil meines Schwagers, zum anderen die Tatsache, dass endlich einmal einer der guten Böcke von jener Wiese zwischen Goretex Gully und Middle Barn zur Strecke gekommen war – wenn auch nur aus dem Grunde, dass er sich ein aus seiner sicheren Heimstatt zu weit herausgewagt hatte.
Aber kehren wir von diesem kleinen Ausflug zurück an den Ausgangspunkt dieser Geschichte: die Fuchsfee mit dem einen Gehör. Ich ging an dem Abend etwas nachdenklich über die Hügel zum Haus. Ich bewunderte diese Füchsin, die klappermager einen Fang voller frischer Mäuse unangetastet ihren kleinen Quälgeistern zugetragen hatte. Und ich beschloss im Stillen, am nächsten Morgen wieder auf diese Wiese zu gehen. Vielleicht würde ich die Füchsin ja erneut zu Gesicht bekommen. Als ich anderntags im Frühdunst aus dem Tal von Westwood hinauf auf die Wiese von Fallen Tree pürschte, war meine Füchsin nicht zu sehen, aber dafür drei ihrer nächsten Verwandten: zwei saßen geduckt vor engen Durchlässen in den Hecken, in die vielbelaufene Hasenpässe führten, ein dritter, ein starker Rüd, mäanderte gemächlich und rotprahlend durch die Wiese. Ich habe dieses Verhalten mehrfach beobachtet und mich immer gefragt, ob die vorherrschende Lehrmeinung, dass der Fuchs allein lebe und jage, wirklich richtig sei. Ich habe aufgrund meiner Beobachtungen immer an der Richtigkeit dieser These gezweifelt, und der britische Wildbiologe David Macdonald beschreibt es in seinem wunderbaren Buch „Running with the fox“: Füchse leben und jagen in Familiengruppen. Sie treiben sich auf die eben beschriebene Weise das Wild gegenseitig zu, und ein Hase oder Kanin, das einen Fuchs auf der Wiese schnüren sieht, wird sich schleunigst auf dem Wechsel in Sicherheit begeben – um dann gegebenenfalls im Fang eines anderen Fuchses zu landen.
Die drei Füchse in der Wiese dieses Morgens ließen sich von meinem Erscheinen wenig beeindrucken, und ich bin der festen Überzeugung, dass sie wussten, dass ihnen von mir kein Unheil droht. Oft und häufig sehe ich, pürsche ich allein durchs Revier, Füchse beim Mausen, auf der Jagd nach Regenwürmern oder Kerfen. Oft schaue ich ihnen zu, wenn sie auf den Fahrspuren in der Morgensonne fletzen, sich den Balg trocknen lassen, zuweilen dabei herzhaft gähnen, die Glieder strecken und dann weiter schüren, hier eine Schnecke verspeisend, dort einen saftigen Käfer. Mehrfach habe ich beobachtet, dass sie an Fasanenhennen samt Gesperr mit schier gegraustem Gesichtsausdruck vorbeigehen, als wollten sie sagen: „Nicht schon wieder Fasan!“. Und tatsächlich gibt es deren in diesem Revier helle Massen, denn der Jagdherr führt auf seinem Besitz eine kommerziell betriebene Fasanenjagd, und alljährlich wird eine große Zahl von jungen Vögeln im Juni in die Volieren gesetzt. Dem allgegenwärtigen kerngrünen Waidgerechtling will ich dazu nur sagen, dass der jetzt sicher schon auf den Lippen liegende Begriff „Kistenfasan“ hier nicht passt, denn diese Volieren werden geöffnet, sobald die Vögel ausgefiedert sind, und so sind die Fasanen, die dann im Winter geschossen werden, in meinen Augen als Wild zu sehen. Diese Methode ist in Deutschland aus Gründen, deren angebliche Richtigkeit ich hier nicht diskutieren möchte, verboten. Ich für meinen Teil genieße es, dass es in Charlton Abbots Fasanen sonder Zahl gibt und erfreue mich an ihrem Anblick. Allerdings mache ich bei der Bejagung des Fuchses – „Charlie“ nennen ihn die Engländer – nicht mit. Denn wie beschrieben geht meiner Beobachtung nach Charlie bei weitem nicht so heftig an den dortigen Niederwildbesatz, wie es sonst immer gesagt wird, und zum anderen: die Zahl der Vögel, die sommers ausgewildert wird, bleibt Jahr für Jahr gleich, und es werden bei weitem nicht alle davon auf den Jagden geschossen. Warum man dann den Füchsen den Überfluss, an dem sie ohnehin zur zu Teilen partizipieren, missgönnt, entzieht sich meinem Verständnis und Begriff.
So lasse ich die Füchse in Ruhe und beobachte sie lieber. Sie wissen das und lassen mich gewähren. Komme ich aber mit einem Jagdgast im Schlepptau des Weges, sehe ich nur noch Luntenspitzen, die in den Hecken verschwinden.
Der Fuchsrüde von Fallen Tree, der an diesem Morgen offenbar als Treiber für die beiden anderen fungierte, ließ mich gut fünfzig Schritt an sich vorüber ziehen und duckte sich noch nicht einmal ins Gras. Blickte mir nur ein Weilchen hinterher und mäanderte dann weiter durch die Wiese, immer auf Sichtbarkeit und Wirkung bedacht. Ich bezog mein Bodensitzel am gefallenen Baum, lehnte die Bin ins Eck und steckte mir ein Morgenpfeiflein an. Es gibt mir wenig schöneres als einen solcherart begangenen Frühlingsmorgen: Dunst und Kühle heben sich mählich, die Sonne schickt erste wärmende Strahlen herab, die Sträucher in den Hecken stehen in voller Blüte, das frische Gras hat diesen fett smaragdenen Ton von Leben und Frische. Alles duftet neu und jung, ja, selbst der Wind in den Bäumen klingt weicher als im Winter. Und wenn dann in all dieser Morgenpracht ein passender Abschussbock daherkommt, dann wird die ganze Szenerie vollends zum Gesamtkunstwerk: dann mischt sich zu Optik, Olfaktorik und Akustik noch die Kulinarik, und ich freue mich auf ein Frühstück mit frischer Rehleber. Der Knopfspießer war bequem den Hang herauf gebummelt bekommen, und als er querab auf siebzig Schritt verhoffte, warf ihn die Kugel direkt in bessere Gefilde. Ich barg den Bock und zog ihn zum Weg. Dann holte ich das Auto, um die Beute zur Versorgung in die Wildkammer zu bringen. Als ich den Jahrling in die Wildwanne wuchtete, fiel mir die klapperdürre Fee wieder ein, und ich beschloss, ein mildtätiges Werk zu verrichten. Anstatt in der Wildkammer brach ich den Bock an Ort und Stelle auf, behielt die Leber fürs Frühstück und legte den Rest des Aufbruchs am Buschsaum des Goretex Gully ab. Sollte sich die Füchsin ordentlich satt fressen daran, und für ihre Welpen wäre dann immer noch genug da. Und richtig: als ich am frühen Nachmittag wieder an der Stelle vorbeikam, war der Aufbruch weg, und in der Schleifspur standen die Fährten eines erwachsenen Fuchses und mehrerer Welpen.
Pürsch und Nachschau der nächsten Tage führte mich in andere Revierteile, brachte Anblicke, Erlegungen und wunderbare Stunden in den Wiesen und den Wäldern. Aber so schön auch die Momente auf Coles Hill, in Bespidge, Sidelands oder Spoonley waren: die Füchsin aus dem Goretex Gully ließ mir keine Ruhe. Mochte es Bewunderung sein oder pure Sentimentalität – und wahrscheinlich war es eher Letzteres denn Ersteres: ich merkte, wie ich bei jeder Pürsch und jedem verhockten Viertelstündlein erwischte ich mich dabei, dass ich die Szenerie mit meinem Glas intensiv nach diesem so typisch asymmetrischen Haupt absuchte. Anfänglich tat ich das Alles noch als gefühlsduselige Spinnerei ab und schalt mich einen Narren, der das Wild zumindest gedanklich domestizierte. Und ich gebe gerne zu, dass es in meiner frühen Schulzeit ein bestimmtest, dahingehendes Erlebnis gab, das mich damals unsagbar fesselte und heute noch klar und deutlich in der Erinnerung abrufbar ist.
Es war im ersten Jahr meiner österreichischen Schulzeit, und ich war in dem Internat kreuzunglücklich. Ich hätte mir zwar eher die Zunge abgebissen, als dass ich meinen Eltern davon erzählt hätte, aber – nun ja: eine schöne Zeit war das nicht. Einen großen Lichtblick aber gab es in diesem Jahr: der Österreichische Rundfunk suchte damals Schulklassen, die zu bestimmten Themen Radiosendungen machen sollten. Meine Klasse hatte sich beworben und war akzeptiert worden: wir hatten ein Portrait des großen Verhaltensforschers Konrad Lorenz in Aussicht gestellt, der damals seine Forschungsstation in Grünau am Almsee hatte. Es war faszinierend, diesen großen Mann und seine Arbeit mit seinen Graugänsen zu sehen und ihn tatsächlich zu erleben, zu sprechen und zu interviewen. Aber für mich war ein anderer Moment an diesem Tag herausragend: Lorenz war mit meinem Großvater gut bekannt, und als wir uns vorstellten, sah er mich einen Augenblick länger an als meine Schulkameraden – zumindest bildete ich mir das ein. Als die Aufzeichnung der Sendung beendet war und wir uns den Wildpark auf der Forschungsstation genauer ansehen durften mit seinen Wisenten, Wildpferden, Fischottern und Wölfen legte sich irgendwann eine schwere Hand auf meine Schulter. Ich drehte mich um und blickte in das gütige, weißbärtige Gesicht des Forschers: „Komm einmal mit, ich will Dir etwas zeigen.“ Lorenz führte mich an eine Stelle des Wildparks, wo er zaunlos in den Wald der Cumberland-Stiftung überging: „Jetzt pass auf!“ Lorenz keckerte in den Wald hinein, und Sekunden später kam unter ebenso lautem Gekecker eine Fuchsfee auf ihn zugerast, deren ganze Körpersprache wie bei einem Hund allergrößte Freude signalisierte. Lorenz breitete die Arme aus, und aus drei Metern Entfernung flog die Fee den Forscher an. Er hielt sie in seinen Armen und sie leckte ihm das Gesicht. Ich stand starr, völlig verzaubert daneben und sah atemlos zu, wie der Fuchs sich an den Mann drückte, mit hochgezogenen Lefzen über das ganze Gesicht lachte und sich von ihm streicheln ließ. Wie in Trance streckte ich meine Hand aus, denn um alles in der Welt wollte ich dieses Tier berühren. Doch meine Finger waren noch nicht einmal in der Nähe des Tieres, da drehte die Fee ihr Haupt zu mir, legte die Gehöre an, kniff die Seher zusammen und fauchte aus Leibeskräften auf mich hin. „Sie lässt sich nur von mir anfassen, von anderen mag sie das nicht“, sagte der Forscher.
Als die Fee nach ausgiebiger Begrüßung wieder aus den Armen von Konrad Lorenz in den Wald gesprungen war, erzählte er mir, wie er das Tier als noch blinden Welpen bekommen hatte. Wie genau das zugegangen war, das weiß ich heute nicht mehr genau. Ich glaube mich zu erinnern, dass das Muttertier überfahren oder sonst wie zu Tode gekommen war und ein Berufsjäger das verwaiste Geheck ausgehoben und zu Lorenz in die Forschungsstation gebracht hatte. Die Geschwister waren sämtliche eingegangen, nur die Fee hatte überlebt, Lorenz hatte sie aufgezogen und auf sich geprägt. Die Fee lebte mehrere Jahre völlig wild im Wald hinter der Station, hatte aber ihre „Ziehmutter“ nie vergessen und kam stets auf seinen Ruf. Bis heute lässt mich dieses Erlebnis nicht los, diese enge Beziehung von Wildtier und Mensch, und viele Nächte habe ich als Schulbub im Internat davon geträumt, auch eine solche Freundschaft mit dem Wild haben zu dürfen. Ein Wunschtraum, der – wenn ich ehrlich bin – eigentlich immer geblieben ist. Und einer, der für mich und vor mir selbst in keinem Widerspruch zur aktiven Jagdausübung steht.
Am letzten Abend vor meiner Abreise aus Charlton Abbots kam ich in letztem Licht noch einmal über die Wiese von Fallen Tree gebummelt. Es war kein rechtes, zielgerichtetes Pürschen mehr, eher ein auf den Wiesen so vor mich Hingehen, heiteren und nichts suchenden Sinns. Der Jahrling stand halt da, breit, schwach und passend. Den Aufbruch ließ ich wie schon einige Tage zuvor unterm Strauchtrauf am Gully liegen. Als ich den Jahrling den steilen Hohlweg ins Tal hinunter zog, war es mir, als wäre da ein roter Schatten zum Aufbruch gehuscht mit seltsam asymmetrischem Haupt.
In London warteten neben der besten Ehefrau und meinen beiden Hunden auch volle Schreibtische sowohl im Büro als auch im Studierzimmer auf mich. Die Arbeit wurde trotz in Angriffnahme leider nicht weniger, sondern eher mehr. So waren es nur Gedanken, die mich ins Revier trugen über die nächsten Wochen und schließlich Monate. Regelmäßiger Briefverkehr und gelegentliche Telefonate mit meinem Freund Georges hielten mich über die Geschehnisse im Revier auf dem Laufenden, und immer wieder flocht ich in unsere Konversationen die Frage ein, wie der Headkeeper mit der Fuchsbejagung nachkäme. Irgendwann musste das auffallen: ich, der ich nie einen Fuchs in Charlton Abbots geschossen hatte oder hätte schießen lassen, ich erkundigte mich mit einem Mal regelmäßig nach diesem Teil der Revierarbeit. Als Georges dann endlich einmal dem Grund dieser unerwarteten Neugier fragte, redete ich mich mit allgemeinem Interesse an allen Dingen, die im Reviere vor sich gingen, heraus. Den eigentlichen Grund, nämlich die Angst von der Erlegung einer einohrigen Fuchsfee zu erfahren, den verriet ich natürlich nicht. Auch schien mir meine Bekannte vor den Nachstellungen des Keepers relativ sicher zu sein: die erstreckten sich auf den näheren Umkreis der Volieren und entlang seiner Fahrtrouten durchs Revier. Solange die Fee sich auf Goretex Gully und die Wiesen von Fallen Tree und Middle Barn beschränkte, sollte ihr wenig geschehen. Dort kam der Keeper so gut wie nie vorbei. Aber auf der anderen Seite von Westwood Valley war eine der größten Volieren des Reviers, und direkt an Fallen Tree grenzten Wald und Wiese von Bee’s an – und das war einer der guten Fasanentriebe. Wollte ich mir auch einreden, dass das nun mal das Lebensrisiko eines Fuchses auf einer intensiv betriebenen Flugwildjagd sei: es gelang mir nicht so recht. Nicht wissend, ob es im Heiligenkanon einen für die Füchse zuständigen Heiligen oder Nothelfer gibt, empfahl ich die Fee der Obhut des Hl. Franziskus und wartete ungeduldig die Blattzeit und meine Fahrt nach Charlton ab.
Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, mich von meiner – so wollte ich das betrachten – Sentimentalität nicht weiter belästigen zu lassen und die Gegend um Fallen Tree erst wieder aufzusuchen, wenn sich dort die Blatterei auf einen erntereifen Bock bot. Aber Ausreden finde ich auch vor mir selbst rasch: es müsste doch irgendwie hinzudeichseln sein, dass ich den guten, wohlvereckten und hochstangerten Bock von Middle Barn irgendwie vors Blatt bekäme – und vielleicht auch vor die Büchse. Denn als ich ihn im Frühjahr auf weite Distanz als bestenfalls mittelalt angesprochen hatte, da war er doch recht weit weg gewesen, und das Licht war auch nicht wirklich gut gewesen an diesem Abend, und überhaupt ist ein Rehbock schnell falsch angesprochen. Möglicherweise war er doch alt?
Sinnvoll wäre es gewesen, unterhalb der Wiese im Stangenholz zu blatten. Aber ich machte aus sehr durchsichtigen Gründen eine lange Pürsch durch Bee’s und über die Wiese von Fallen Tree. Als ich bei Middle Barn anlangte, stand der Wind erwartungsgemäß schlecht, und ich bummelte derhalben den gleichen Weg zurück. Meine Freundin bekam ich nicht zu Gesicht. Ich schob es auf das hohe Gras. Den Keeper traf ich am nächsten Vormittag, als ich einen Bock, den ein Mitjäger erlegt hatte, aus der Decke schlug und grillfertig machte. Wie immer gab es den üblichen kleinen Chat über dieses und jenes und eine beiläufige Frage, was Charly und Konsorten denn so trieben: „Ganz schlechtes Jahr dieses Jahr. Wir haben mit Mühe und Not drei oder vier Füchse erwischt bisher. Alle drüben in Bespidge.“ Ich rechnete kurz im Kopf nach: von Fallen Tree und Goretex Gully hinüber nach Bespidge waren es gute drei Kilometer wie die Krähe fliegt. Der Fuchs mäandert nun ganz anders, und in diesem reich besetzten Revier wohl kaum über diese Distanz. Ich wandte mich kurzfristig wieder meinem Zerwirk-Werk zu, um die Erleichterung über diese Nachricht nicht allzu deutlich in meinem Gesicht lesen zu lassen.
Jetzt, wo ich sicher sein konnte, dass der Fee zumindest von Seiten des Berufsjägers nichts geschehen war, wollte ich sie natürlich wiedersehen. So suchte ich nach jedem erdenklichen Vorwand, um meine Wege in ihren Gewann zu führen. Selbst den ein oder anderen Jagdgast schleifte ich über die dortigen Wiesen – mit wenig Aussicht auf Erfolg für den Gast, aber zumindest mit der Chance für mich, meine Bekannte in Anblick zu bekommen. Es gelang nicht. Generell bekam ich wenig Füchse in Anblick, und die Gegend um Fallen Tree schien, was die Familie Reynard anging, völlig entvölkert. An sich war die Blattzeit erfolgreich: die Gäste brachten einige hochpassable und zum Teil sehr gute Böcke zur Strecke, mir selbst begegnete in Oxleaze ein ausnahmsguter und für lange Zeit mein bester Bock aus Charlton Abbots, von dem an anderer Stelle noch zu berichten sein wird. Aber als ich zurück nach London fuhr, fehlte im Bilderbogen der Erlebnisse ein Bild, und diese Leerstelle ging mir auf bestimmte Weise näher, als ich mir das selbst zugestehen wollte.
Im frühen Jahr kam ich wieder in die Cotswolds, es ging darum, den ersten großen Gaissenriegler vorzubereiten. Eine Woche Zeit hatten Georges und ich uns dafür genommen: die Triebe waren festzulegen, die Stände auszuwählen und einzurichten, und ein wenig Pürscherei auf Gaiss und Kitz war auch geplant. Wenig Wunder, dass mein erster Gang über Fallen Tree führte. Als ich von Bee’s her durch die Hecke kam, glaste ich die Fläche Meter für Meter ab, in der Hoffnung, das Haupt meiner Fee zu entdecken. Sie war nicht zu sehen, dafür aber standen Gaiss und Kitz ganz unten in dem Eck, das Goretex Gully und die Hecke zur nächstgelegenen Wiese bildeten. Ich schlich mich außer Sicht an den oberen Rand der Wiese, um so in der Überriegelung zum Wild auf Höhe des Bodensitzes beim umgestürzten Baum zu kommen. Dort konnte ich mit gewissem Sichtschutz stichgerade zum Sitz gelangen und – sollte das Wild ausgehalten haben – einen Schuss auf das Kitz loswerden. Es gelang, und es gelang übergut: das Kitz fiel im Knall, die Gaiss sprang aber nicht wie erwartet ins Dickicht des Gully ab, sondern ging im Stechschritt sichtlich alertiert auf und ab. Wahrscheinlich hatte das Eck, in dem sie stand, den Schusshall so verworfen, dass sie das Ereignis nicht sofort zuordnen konnte. Jedenfalls gab sie mir genug Zeit, meine Kipplaufbüchse erneut zu laden und einen zweiten, abermals erfolgreichen Schuss zu tun. Solche Gaiss-Kitz-Doubletten sind mir – speziell mit meiner ejektorlosen Ferlacher Einschüssigen – selten gelungen. So war ich recht zufrieden mit Pürsch und Erfolg.
Ich trat nach einigen Andachts- und Dankminuten ans Wild, gab Letzte Bissen und Bruch und machte mich ans rote Werk. Das Kitz lag nach einigen Minuten aufgebrochen da, und als ich mich an der Gaiss zu schaffen machte, hatte ich das untrügliche Gefühl, dass mir jemand zusehe. Man kennt das: die Blicke, die sich da in den Rücken bohren, sind körperlich spürbar. Georges konnte es kaum sein, der weilte in einem gänzlich anderen Revierteil. Ich wandte mich um, ob da ein Spaziergänger oder der Keeper stand, aber die Fläche war leer. Ich machte mich wieder an die Arbeit, aber der Eindruck des intensiv Beobachtetwerdens blieb. Da kam mir der Gedanke. Konnte, sollte womöglich? Ich drehte mich abermals um, sehr viel langsamer und behutsamer diesmal und sah nicht auf die Wiesenfläche, sondern äugte die Kante von Gras zu Strauch ab. Auf fünfzehn Schritt saß sie da: hoch aufgereckt, das eine Gehör nach vorne gewandt, den Fang leicht geöffnet. Dann hob sie leicht das Haupt, und ich blickte in ihre Seher. Die Fee duckte sich leicht ins Kraut und machte – ja, man verzeihe mir bitte nun diesen eher kynologischen Ausdruck – Platz, und zwar genau so wie meine Hunde, wenn ich ihnen beim Essen mit scharfer Stimme sage, dass niemand bettelnde Hunde schätze: die Vorderbranten lang und parallel ausgestreckt, das Haupt hoch, mit wachem Blick und glitzernden Lefzen. Die Fee bettelte nicht, nein, sie wartete geduldig darauf, ob dieses seltsame zweiläufige Wesen da vor ihr wieder einmal Fraß da ließe. Ich ließ, und reichlich.
Allerdings befand ich mich nun in einer gewissen Zwickmühle: so sehr ich mich darüber freute, dass meine Freundin lebte, wohlauf war und sich obendrein ganz offensichtlich meiner als Freund erinnerte, so hatte ich nun doch wie Stück Wild liegen und wenig Lust darauf, beide gleichzeitig zum nicht unbedingt nahe stehenden Auto zu buckeln. Die beiden Stücke mit einem Taschentuch oder einer abgeschossenen Patronenhülse zu verstänkern, wie es das Lehrbuch vorschreibt, erschien mir ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen, denn die Fee zeigte vor dem Geruch des Menschen und seiner jagdlichen Paraphernalien deutlich weder Furcht noch Respekt. Was tun? Mir blieb letzten Endes keine andere Wahl, als mich auf die Hoffnung zu verlassen, dass es auch zwischen Fuchs und Mensch generellen Anstand und gute Sitten gibt. Ich drehte mich langsam zur immer noch wachsam daliegenden Fee um, die ihre Seher unverwandt auf den Aufbruch geheftet hielt und sagte mit halblauter Stimme: „Sei bitte so anständig und lass mein Essen in Ruh, ich hab Dir weiß Gott genug für Dich hingelegt.“ Dann lud ich mir die Gaiss auf und brachte sie zum Auto. Die Fee drückte sich lediglich ein wenig tiefer ins Kraut, nahm ihren Blick keinen Sekundenbruchteil vom Aufbruch und ließ mich auf wenige Schritt an ihr vorbeigehen. Als ich wenige Minuten später zurückkehrte, saß die Fee am Aufbruch und tat sich mit hörbarem Behagen gütlich daran. Als sie mich kommen hörte, schrak sie zusammen und sprang mit einem großen Satz seitwärts ins Gebüsch. Dort deckte sie sich notdürftig hinter ein paar Grashalmen und ließ ihre „Beute“ nicht aus dem Blick. Das Kitz war von ihr nicht berührt worden, die drei, vier langen, trockenen Grashalme, die ich darüber gelegt hatte, waren nicht verrückt worden. „Gutes Mädel!“. Mit diesen Worten nahm ich das Kitz auf und ging reich an Beute, noch reicher an Erleben, meines Wegs. Nach einigen Schritten wandte ich mich um. Die Fee saß wieder auf dem Luder, drehte nun ihrerseits sich um, und für einige Sekunden sahen wir uns an. Man soll und darf Wild nicht vermenschlichen. Aber ich glaube, dass in meinem wie in ihrem Blick so etwas wie gegenseitige Achtung lag.
In den nächsten Tagen sah ich sie öfter: entweder beim Mäusefang auf der Wiese, hin und wieder dösend auf einem der raren Sonnenfleckchen, am letzten Tag vor dem Riegler in wildem Tanz mit einem Rüden. Ranzzeit. Für morgen war mir nicht bang um sie – Jagdherr Tristan, großer Reiter und Huntsman, zeitweise gar Joint Master of the Cotswolds Hunt, hatte über die Füchse Schonung ausgesprochen, damit die berittene Jagd nicht ums Wild gebracht würde. Ich lobte ihn und seine gütige Weisheit im Stillen, denn die Jagd führte, wenn sie über Tristans Land ging, am anderen Ende des Reviers durch und berührte den ganzen Komplex von Westwood nie.
Seit diesen Tagen ließ ich von jedem Stück, das ich auf den Wiesen meiner Fee schoss, den Aufbruch für sie liegen. Sie lohnte es mir mit Vertrauen. Kam ich des Weges, blickte sie kurz auf und ließ mich dann passieren, kam sie des Weges, setzte sie sich auf die Keulen, blickte zu mir her, spielte wie zum Gruß mit dem Gehör und ging dann in aller Ruhe und Vertrautheit ihrer Wechsel. Manchmal sah ich sie, wenn sie auf Treibjagd im Verband ihrer Familiengruppe an einem Heckendurchlass saß und auf von den anderen zugedrückte Beute lauerte – als Treiberin sah ich sie nie. Und im späteren Mai zeigte sie mir gar einmal ihr Geheck und ließ die junge Brut vor mir im Gras paradieren. Ich fühlte mich geehrt und geschmeichelt.
Einige Wochen später allerdings gab es ein Erlebnis, das mich tief berührte. Ganz gegen Tradition und Gewohnheiten war ich im Juni für ein längeres Wochenende ins Revier gekommen. Der Jahrlingsabschuss im Mai war wegen schlechten Wetters beklagenswert untererfüllt. Und ging es auch schon auf die Feiste zu: für dieses Jahr standen einige gute Ernteböcke an, und ich wollte mir das ohnehin zähe Blatten im hohen Gras nicht durch ein Zuviel an präpotenten Jünglingen stören lassen. Dennoch war’s leichter gesagt als getan: das Wild wurde schon hübsch heimlich, und hatte ich Anblick, dann waren es keine passenden Jahrlinge. Ich tigerte reichlich erfolglos umher, ich saß mir den Hintern platt – es war wie verhext, oder besser gesagt, wie üblich um diese Jahreszeit: kaum Wild zu sehen, wenn, dann nur kurz, meist mittelalt, kaum ein Alter, gar kein Jahrling. Aber ich war nun einmal hier, unverrichteter Dinge oder gar vorzeitig abzureisen kam nicht in Frage. So pflockte ich eines späteren Nachmittages mit ausreichend Tabak und Lesestoff versehen auf meinem Bodensitz am umgestürzten Pappelstamm und genoss Freiheit, Sonne, generell die ganze Atmosphäre von Fallen Tree. Ich hatte gute Muße , die einsehbare Fläche blieb wildleer. Wäre ich noch so voll frischer Passion gewesen wie am Tag meiner Ankunft, hätte ich mich sicherlich das ein oder andere Mal umgewandt und die Hecken hinter mir abgeglast. Aber ich war durch die Misserfolge der vorangegangenen Pürschen und Ansitze – nun ja – ein wenig frustriert, und da wird der Mensch nachlässig und schlampig. Abgesehen davon war es ein wirklich gutes und spannendes Buch, das ich da in Händen hielt. Seite um Seite führte ich mir zu Gemüt und vergaß dabei mehr und mehr auf Wild und Welt.
Irgendwann sah ich dann aber doch einmal auf, und mein Herz ruckte freudig: brettbreit hockte meine eingehörige Fee auf der Wiese. Gut sah sie aus, der Balg saß straff und glänzte in der Abendsonne, das eine Gehör spielte hin und her. Mit leicht geöffnetem Fang hockte sie auf ihren Keulen und sah über vierzig Schritt zu mir her. Das heißt: nein. Sie sah nicht her, sie sah mich an, unverwandt, reglos und vertraut. Man halte mich nun meinethalben für sonderlich, doch mir ging der Blick der Fuchsfee durch und durch. Mag sein, dass sie frischen Aufbruch sich von mir erhoffte und wenig erbaut darüber war, dass ich es am jagdlichen Eifer mangeln ließ, mag sein, dass ich mich ertappt fühlte dabei, dass ich ein schnödes Buch las anstatt die Bände der Natur zu studieren. Sei dem wie es sei, ich nickte wie zur Bestätigung des unausgesprochenen Vorwurfs, klappte das Buch zu und nahm das Glas zur Hand. Dass auf den Wiesen vor mir bis zum Gully und drüben bei Middle Barn kein Reh zu Wege war, das konnte ich auch mit freiem Auge sehen. Aber wer gefehlt hat, der versucht halt, durch ostentatives Bemühen die Scharte wieder auszuwetzen. So glaste ich brav Halm für Halm und Strauch für Strauch ab, nahm dann das Glas wieder von den Augen und warf meiner Fee einen Verzeihung heischenden Blick zu. Sie hielt mich weiter im Blick, beugte dann mit einem Mal ihr Haupt, reckte den spitzen Fang vor und wandte ihn dann langsam zu ihrer Rechten, meiner Linken hin. Nahm ihn dann wieder gerade und hob das Haupt wieder, nur um es nach wenigen Sekunden wieder zu senken und nach rechts zu wenden. Dieses Spiel trieb sie drei oder vier mal. Dann begriff ich. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber die Fee deutete unmissverständlich zur Hecke dreißig Schritt zu meiner Linken, deren breiter Durchlass in die nächste Wiese führte. Leichter Wind stand von dort her.
Bei aller offen eingestandenen Sentimentalität, die mich dem Wild gegenüber zuweilen befällt, kam ich mir jetzt doch ein wenig seltsam vor. Sollte die Fee Witterung von etwas für sie erstrebenswert Essbarem aufgenommen haben, von etwas, dass für sie zu strecken zu groß war, dessen Erlangung sie nun von mir erhoffte? Das war nun doch ein wenig zu sehr Kitsch en facon Disney. Aber die Fee deutete wieder und immer noch zum Durchlass und zur Hecke hin. „Was soll’s?“, sagte ich mir. Ich konnte nun hier hocken bleiben und dem Fuchs weiter zusehen, oder ich konnte bei gutem Wind und bester Deckung an die Hecke pürschen und einen raschen Blick durch den Durchlass tun. Das war nun grad schon Rock wie Hose. Ich nahm meine Büchse und das Dreibein und machte mich auf den Weg.
Hinüber zur Hecke war es kein Kunststück. Aber die letzten Schritte zum Durchlass und dort hinein, das wollte langsam und übervorsichtig unternommen sein. Blickt man von der anderen Seite, von der dortigen Wiese aus auf den Durchlass, dann ist er ein heller Fleck im Dunkel des Strauchwerks, und besonders Rehwild als Bewegungsseher erkennt sofort jede Änderung dieser hellen Stelle auch noch aus dem letzen Winkel seiner Lichter. Minutenzeigerlangsam schob ich mich vor. Jetzt wurde das Blattwerk der Hecke langsam licht, das Grün der Wiese schimmerte schon hindurch, und in diesem Grün stand ein unverkennbarer, hellroter Fleck. Mir gab’s einen siedheißen Riss mittendurch, und mich packte das Jagdfieber. Das Reh hatte das Haupt unten und äste sich von mir fort. Ich nahm die Büchse von der Schulter, klappte das Dreibein auf, hielt es mit der rechten Hand unterm Vorderschaft fest und schob mich so zum schnellen Schuss bereit weiter in die Lücke hinein.
Der Bock – sein Spiegel verriet ihn als solchen – war so mit dem Äsen beschäftigt, dass ich nicht nur den Durchlass, sondern sogar die andere Seite der Hecke gewann, dort drei Schritt zur Seite tun konnte und nun mit meiner Tarnjacke gut gedeckt gegen den Hintergrund der Hecke Stellung beziehen konnte. Bock ja, soviel war sicher. Aber was für ein Bock, dazu konnte ich noch nichts sagen, er heilt sein Haupt noch immer unten. Wenigstens änderte er jetzt seine Richtung und zog langsam breit. Die Waffe hatte ich bereits im Anschlag, mit dem Zielglas hielt ich auf die Stelle im schon gut kniehohen Gras, an der das Haupt des Bockes war. Die Sicherung war bereits nach vorne geglitten, der Finger lag am Stecherzüngel. Mit zusammengepressten Lippen mäuselte ich den Bock an. Im Aufwerfen sah ich zwei knapp lauscherhohe Gäbelchen. Dann warf es den Bock ins Gras. Ganz selten nur haben mir nach einem Schuss so die Knie gezittert wie damals. Die Zigarette brachte ich kaum aus der Schachtel, und während ich sie rauchte, wurden mir die Beine so weich, dass ich mich ins Gras setzen musste. Als ich mich dann wieder beisammen hatte, stand ich auf, trat ans Wild und begann die rote Arbeit. Den Aufbruch ließ ich mit einem halblauten: „Dank’ Dir, Du hast es Dir wirklich verdient!“ im Gras liegen. Dann schränkte ich den Bock, hing ihn mir über die Achsel und ging durch die Wiese Richtung Middle Barn, wo mein Land Rover stand. Nach vierzig Schritt blieb ich stehen und blickte noch einmal zurück auf die Stelle dieses raren Erlebnisses. Im Durchlass der Hecke saß ein Fuchs mit nur einem Gehör und leckte sich die Lefzen.
Ich bin selten einmal so nachdenklich von einer Jagd heimgekehrt wie an diesem Abend. Und darüber, dass der Jagdherr an diesem Abend bei Freunden zum Diner geladen war und ich mithin allein im Hause war, darüber war ich nicht im mindesten traurig. Ich öffnete mir eine Flasche, die Hausherr Tristan großzügig bereitgestellt und mit weisem Vorausblick bereits auf Trinktemperatur gebracht hatte und ließ diesen unwirklichen, diesen unglaublichen Abend noch einmal vorm inneren Aug werden und vergehen. Ich verbot mir jegliche Sentimentalität in der Beurteilung dessen, was ich da erlebt hatte und dessen Ergebnis nun in der Wildkammer hing. Ein Wildtier hatte mir den Weg zu seiner und meiner Beute gezeigt, hatte sich mit mir eingelassen, hatte – offensichtlich gesund – die Scheu vor dem Erzfeind Mensch abgelegt. Mehr noch, das Tier hatte Vertrauen gefasst, hatte mir sein Wertvollstes, seine Jungen gezeigt und hatte mich (so zumindest fühle ich es) zwar mittelbar, aber dennoch an der Aufzucht der Jungen teilhaben lassen. Die Fuchsfee hatte mit mir – recht besehen – gejagt. War es vermessen zu denken, zu glauben oder zu fühlen, dass ich jetzt an der Stelle stand, an der vor Urzeiten Mensch und Wolf gestanden hatten, an just der Schwelle, wo aus Nahrungskonkurrenten eine Zweckgemeinschaft wurde, die bis heute andauert? Es mochte der Wein sein, der mich in große Gefühle trieb. Aber eines wurde mir an dem Abend sehr klar und sehr bewusst: ich hatte eine Freundin gewonnen, wie sie rarer kaum sein mochte. Und so sah ich die Fee – und so sehe ich sie heute in der Erinnerung: als meine Freundin.
Es dauerte einige Zeit, bis ich meine Freundin wiedersehen sollte. In den damals verbliebenen Tagen suchte ich Fallen Tree nicht mehr auf. Zum Einen waren andere Ecken wichtiger und einfacher zu bejagen, zum Anderen hatte ich eine gewisse Scheu, wieder dorthin zu gehen. Vielleicht hatte ich mir ja auch nur alles eingeredet, vielleicht hatte der Fuchs nicht zur Hecke und dem Bock dahinter hingedeutet sondern nach einem fetten Mäusenest neben sich in der Wiese geschielt und zugesehen, was der Mensch da vorne wollte. Und eines wusste ich ebenfalls sicher: würde ich wieder auf diese Wiese gehen, und wäre ich dort, würde ich den Zauber dieses Erlebnisses wieder haben wollen. Und das schien mir so vermessen, dass ich die Wiese mied.
In der Blattzeit dieses Jahres war ich ein oder zwei Mal dort, sah aber meine Freundin kein einziges Mal. Ich sorgte mich nicht darüber, denn sommers steht das Gras in den Wiesen gut brusthoch. Ein Reh kann man darin kaum sehen, und einen Fuchs erst recht nicht. Zudem hatte ich, als ich dort war, das klare Gefühl, dass es ihr gut gehe. Im Winter kam ich wieder nach Charlton Abbots, allerdings war es mir diesmal nicht um die Rehe, sondern um die Fasanen zu tun. Es war das Jahr, in dem ich mein Hochzeitsgeschenk von Tristan und Georges einlöste und zwei prachtvolle Tage auf hoch und schnell streichende Fasanen jagen durfte. Diese Jagd ist im ersten Buch beschrieben worden, aber es war mir schon ein sehr gutes Omen, dass der erste Trieb des ersten und der letzte Trieb des letzten Tages so gelegt waren, dass das Wild über die Schützen hinweg auf die Wiesen von Fallen Tree und Bees hinausgetrieben wurde. Im ersten dieser beiden Triebe schoss ich nicht sonderlich gut. Im letzten Treiben dieser großen Jagd kamen mir zwar wenige Fasanen, weil ich fast am Ende der Schützenkette stand, aber auf die, die mich anstrichen, kam ich – für meine bescheidenen Verhältnisse – prachtvoll zurecht. Der letzte Vogel dieses Tages ist mir in besonderer Erinnerung: von zehn Fasanen, die über meinen Stand in großer Fahrt und Höhe herstrichen, hatte ich unglaubliche sieben heruntergeholt. Endlich war es – nach vielen schweren und anstrengenden Schüssen in den Trieben zuvor – freies und leichtes Schießen geworden: ich hatte Schwung und Blick, und hob ich die Flinte ins Ziel, dann fiel es auch. Dann aber kam ein Bukett von Fasanen, und ich beging den dümmsten Fehler, den man auf der Schrotjagd begehen kann: ich ließ Gier das Ruder übernehmen. Anstatt ruhig und überlegt wie bisher Vogel für Vogel zu beschießen, wollte ich nun alle auf einmal haben, und bekam so natürlich keinen. Ich stocherte zweimal zwei Schuss irgendwo in die Lücken des Buketts hinein und schalt mich im Absetzen der Flinte einen rechten Trottel. Dann riss der Flug – es ging schon auf das Ende des Triebes hin – ab, und mein Lader Jim meinte, es wäre nun vorbei, ich könnte genauso gut entladen. Da er auf dieser Jagd seit Jahren lädt und zudem ein guter Schießlehrer ist, vertraute ich ihm, entlud meine Flinte, hängte sie in meine Armbeuge, gab ihm aber – wahrscheinlich aus reiner Gedankenlosigkeit – die beiden Patronen nicht zurück, sondern hielt sie in meiner Rechten fest. Im Gespräch ließen wir die beiden Tage Revue passieren, sahen den anderen Schützen bei Glanz oder Elend zu, kommentierten deren Fähigkeiten, genossen die letzten Minuten dieses Jagdtages. Und dann, als der Peloton der Schüsse schon abgeebbt war, als kein Treiber mehr rief, hob sich ganz droben im Hang vor uns ein einzelner Hahn heraus, schraubte sich empor und strich dann in fallender, sausender Fahrt auf mich her. Ich schob die Patronen, die ich immer noch in der Hand hielt, ins Lager meiner Gambetta, schloss das Gewehr, hob es, und der Vogel packte hoch oben Stingel und Schwingen ein und fiel in weiter Parabel herab. In just diesem Moment sah ich vor meinem inneren Auge droben auf den Wiesen einen Fuchs sitzen, der sah dem Fall des Vogel zu, und als der federstiebend aufschlug, war er über der Beute und schleppte das noch warme Federwild davon. Als die Fee in der Hecke abtauchte, war es mir, als hätte sie nur ein Gehör.
Es dauerte bis zum April dieses Jahres dass ich wieder nach Fallen Tree kam. Aber von meiner Freundin war dort nichts zu sehen. Füchse ja, aber alle hatten zwei heile Gehöre. Ich machte mir insgeheim Sorgen. Im Februar hatten wir unseren jährlichen Gaissenriegler gehalten. Wohlweislich hatte ich jeden einzelnen Schützen im dortigen Bereich selbst abgestellt und wieder vom Stande abgeholt, aber weder in den mündlichen noch in den schriftlichen Streckenberichten war von einem erlegten Fuchs die Rede gewesen. Aber konnte ich sicher sein, dass mir alle Schützen auch jede Begebenheit, jeden Schuss, ob Treffer oder Fehler, auch wirklichkeitsgetreu berichtet hatten? Möglicherweise waren aber auch Keeper oder Underkeeper doch einmal auf den Wiesen vorbeigekommen, und die machten mit Charly und seiner Sippe kein Federlesens. Das erste Mal war mir auf der Heimfahrt von Charlton Abbots das Herz schwer.
Auch in der Blattzeit war meine Freundin unauffindbar. Ich mochte dies zwar dem hohen Gras zuschreiben, aber tief in mir drin war aus Sorge Angst geworden. Zwar hatte ich nach der Rehbrunft Zerstreuung genug, denn meine Korrespondenz in London war zu Ende, mit Weib und Hunden zog ich zurück nach Süddeutschland. In all dem Trubel, der Hektik und der Unruhe eines Umzugs über so weite Distanz verging dennoch kein Tag, an dem ich nicht zumindest einmal an die Fee mit dem einen gehör gedacht hätte. Es dauerte lange, bis ich wieder nach Gloucestershire kam: im nächstfolgenden Spätwinter fand kein Gaissenriegler statt, da wir das Geschlechterverhältnis perfekt balanciert hatten und nun versuchsweise den Eingriff alle zwei Jahre vornehmen wollten. Und so war es Mitte Mai, beinahe zwei Jahre nach unserer letzten Begegnung, als ich mein Auto wieder über die heckengesäumten engen Straßen der Cotswolds nach meinem englischen Juwel steuerte.
Fortsetzung in Teil II
Sei's drum. Mir war es wichtig, diese Geschichte zu schreiben.
Eine Freundin
Blassblau der Himmel, wie er halt im englischen Frühling so ist. Auf meinem Erdsitz hinter dem toten Pappelstamm, dessen Zwilling in meinem Rücken wuchs und mit hängenden Zweigen um seinen gefallenen Bruder trauerte – die Wunde, die dessen Tod ihm gerissen, war an den Rändern schon mit Rindenschorf umfasst und heilende Algen hatten sich auf das blanke Holz darin gelegt – hatte ich mich recht behaglich eingerichtet und genoss diesen Abend aus vollem Herzen.
Die letzten Tage war das Wetter wenig charmant gewesen, und als ich aus London ins Juwelenrevier gereist war, hatte das Thermometer meines Cabriolets vielleicht sieben oder acht Grad gewiesen. Mir war nichts weiter drum: ich hatte die bleierne Luft des 8-Millionen-Molochs lange Wochen ohne Pause meine Lungen peinigen lassen. Kaum hatte ich bei Oxford die Autobahn verlassen, kaum hatte ich die Universitätsstadt durchquert, hatte ich das Automobil an den Straßenrand gesteuert, das Dach geöffnet, mich in die warme Tweedjacke gehüllt und war unter einem zwar kalten, aber freundlichen Himmel offen weiter gefahren. Freund Georges empfing mich breit grinsend vor dem Manor, und lachte mit schwerem Akzent die Worte hervor: „Frische Luft und kaltes Wasser sind gesund für junge Männer!“
Ja, er hatte recht. Den Winter über hatte ich vor mich hin gekränkelt, eine schwere Erkältung hatte mich gepackt und über viele Wochen nicht aus den Klauen gelassen – selbst das geliebte Tabaksrauchen hatte ich darob aufgegeben. Aber jetzt, nach der Fahrt über Land in kalter, klarer Luft auf kleinen, engen und winkeligen Sträßchen, entlang hoher Hecken und hinter steinernen Mauern herum, an alten Höfen vorbei und durch pittoreske Dörfer, in denen der kleine Bach, der den Anwohnern früher als Waschgelegenheit für Alltags- und Sonntagssaat gedient hatte, nicht über steinernen Brückenbogen, sondern in ziegelsteingepflasterter Furt zu überque3ren war, wo der Kirchturm, Steeple im Englischen so weithin über Land leuchtete, dass er den Landedelleuten als Ziel eines scharfen Rittes diente um die Wette einer Flasche feinen Weines oder um den Kuss einer schönen Frau, die am Ende dieser Kirchturmjagd, dieser steeple chase stand und der von Lebenslust und Reiterglück erhitzten Burschen harrte – diese Fahrt hatte auch von mir jede Spur von Stadt und Krankheit fortgeblasen. Mit heißrotglühenden Wangen war ich aus dem Wagen gesprungen und hatte auf Georges Worte froh gerufen: „At least one useful thing England gave us in exchange for our Hannoverian kings!“ Wenigstens diese eine löbliche Einrichtung körperlicher Abhärtung und Ertüchtigung durch klare Luft und kaltes Wasser hatte Deutschland erhalten dafür, dass es aus dem Hause Hannover vom ersten Georg bis zur großen Viktoria immerhin sechs gekrönte Häupter bekommen hatte – und die schlechtesten waren es nicht gewesen!
Samstag war es, Mittag war es, und vor mir lag eine frühe Maiwoche an einem der schönsten Orte dieser Welt, nur der Jagd und langen Geschichten vorbehalten. Doch kaum hatte ich mein Gepäck im Gartenzimmer verstaut, meine Kippläufige zusammengesetzt, Stadtfrack gegen Jagdzeug vertauscht, kaum war ich fertig zu großen Taten vors Haustor getreten, zogen von Westen, von den Commons her dunkle Wolken übers Haus, warf aufkommender Sturm Nebelfetzen über den Dachfirst, fielen Baro- und Thermometer um etliche Einheiten. Ja, so ekelhaft wurde das Wetter, dass wir dem Wilde sicheren Schirm und Schutz wünschten und uns ins nahe Cirencester verfügten um beim dortigen Jagdausstatter meine doch zu sehr auf den an sich positiven Wetterbericht gebaute Ausrüstung hinsichtlich der Kriterien „Warm“ und „Wasserdicht“ zu vervollständigen. Denn hatte ich auch noch nicht gelernt, dass britische Meteorologen vom Wetter grad ebensoviel verstehen wie ihre deutschen Kollegen – nämlich nichts –, so wusste ich doch so viel: was der Wind an frischem Unbill über Wontley Farm heran treibt, das bleibt zumindest für drei Tage in unserem Tal von River Coln und Beesmoor Brook hängen. Und grad so kam es auch.
Es war kaltes und nasses Jagen. Mochte das neue Gewand auch noch so dicht und gut sein: nach kurzem Gang durch die Wiesen wogen die Hosen bleierne Pfunde, und schloff ich durch eine Hecke, dann schütteten mir Weißdorn und Hagdorn noch ähnliches Gewicht auf die Schultern. Nach jedem Gang schrie die Büchse nach frischem Öl, und die Jacke wollte in der recht englisch klammkalten Halle des Hauses nie trocknen. Wahrhaftig hatte ich Albion in den Jahren zuvor anders kennengelernt: wann immer ich aus Deutschland nach Charlton Abbotts gereist gekommen war, strafte das Wetter jegliches kontinentale Vorurteil über die generelle Schlechtigkeit der meteorologischen Gegebenheiten auf den Inseln Lügen. Auch der erste Sommer nach der Übersiedelung ins Königreich war so heiß gewesen, wie man ihn sich nur hätte wünschen mögen. Doch mit dem September des ersten Jahres als loyal subject to Her Majesty The Queen hatte es nur herzlich wenige Tage gegeben, an denen der Himmel nicht bittere Zähren vergossen hätte – wahrscheinlich über Ihrer Majestät Regierung unter dem angeblich recht ehrenwertem Tony Blair schändliches Gehabe! Der Jagderfolg in diesen Maitagen war dementsprechend: zwar fährtete sich das Rehwild überreichlich im nassen Boden, aber zu Gesicht bekamen wir kaum mehr als nichts. Georges hatte durch glücklichen Zufall zumindest einen Jahrling in die Wildkammer hängen können, aber meine Patronentasche hatte bislang noch das gleiche Gewicht, das sie auch bei meiner Abreise aus London gehabt hatte. Entschädigt hatte mich nur der Anblick zweier hochrespektabel veranlagter Böcke im adoleszenten Alter – und halt der innere Friede, den das – auch erfolglose – Pürschen aus der freien Hand im freien Land mit sich bringt.
Aber nichts währt ewig, auch nicht das schlechteste Wetter. Und so grüßte mich, als ich im frühen Licht des vierten Morgens vors Haustor trat, ein Himmel, aus dessen grauen Schleiern erste blaue Flecken lächelten, und die Ränder darum waren rosenfarben überhaucht. Und in den Wiesen südlich von Hank’s Gorse war ein schwacher Gabler von meiner Kugel gefallen und hatte einen weißblühenden Schlehenzweig als ortsgerechten letzten Bissen in den Äser erhalten. So saß ich denn – endlich ohne schweres Zeug am Leib – recht froh und zufrieden in meinem Erdsitz hinter dem Pappelstamm, der dem Ort den Namen „Fallen Tree“ gegeben hatte. Glas und Spektiv lagen auf dem Sitzbrett zu meiner Linken, die Büchse lehnte vor mir am Pfosten. Auf meinen Schoß lag ein Buch von Harry Paget Flashmans haarsträubenden Abenteuern und heißen Amouretten zu Zeiten des Sepoy-Aufstandes, und alle paar Zeilen guckte ich über die Wiesen hinweg, die Richtung Goretex Gully abfielen. Lang regte sich nichts, erst nach drei Viertelstunden zog weit im Osten ein einzelnes Reh den Hang herauf: mochte wohl ein Jahrling sein, trug auf seinem Haupt links eine etwas über lauscherhohe Gabel und rechts eine sichtlich auf halber Höhe abgebrochene Stange, war aber groß an Bau und stark im Wildbret, und so blieb die Büchse wo sie war und ich freute mich an seinem Anblick – auch wenn ich still rechnete, wann sich meine heutige Zurückhaltung in besserer Ernte hätte lohnen mögen. Ich sah ihm lange zu, wie er sich durch die Wiese äste und dann durch die Hecke in Richtung des nachbarlichen Winterweizens empfahl. Als er fort war, blieb die Wiese lange Zeit ruhig – wenn man einmal von den zahlreichen immer noch balzenden Fasanen absah, deren kupferrote Brust und stahlgrüner Federhelm allenthalben aus dem Halmenmeer strahlte. Dazu noch einige vier oder fünf Hasen, die auf schon dem Urgroßvater Blume altbekannten Pass ausliefen: an Niederwild gab’s hier keinen nennenswerten Mangel. Ich fläzte gemütlich in meinem Bodensitzel vor mich hin, delektierte mich am Schauspiel und ließ den Herrgott einen recht guten Mann sein. Und wie ich so meine Blicke hinüber und her übers Gras schweifen ließ, war da etwas, das in die Farbsymphonie und generelle Stimmung nicht so recht hineingehörte.
Das war ein anderer Ton, warm und leuchtend wohl, aber härter, straffer, weniger weich. Ich brauchte meine paar Minuten, bis ich den Flecken hatte, auf dem der störende Ton lag. Rot schimmerte es durch die Grashalme. Aber das war nicht das Rot eines Rehs, das um diese Jahreszeit und bei obwaltender Witterung ohnehin noch eher grau wäre. Das war satter, tiefer, kräftiger im Ton. Ich nahm mein Glas hoch und entdeckte über dem roten Halbrund rechts ein schwarzes Dreieck – aber da, wo links sein Pendant hätte sitzen müssen, da war nur ein dicker, schwarzer Strich. Ganz schlau wurde ich daraus nicht. Ich holte das Spektiv aus der Tasche, visierte die Stelle an und zog das Bild langsam scharf. Mir ist dieses Scharfziehen in der Wildbeobachtung immer einer der spannendsten Momente: erst ist da nur ein verschwommenes Farbenmeer, dann wird der eine, anvisierte Punkt schemenhaft sichtbar. Und langsam steigt die Schärfe vom Vordergrund her immer tiefer ins Bild, bis endlich das Objekt zum Greifen nah und klar ersichtlich vor dem Auge steht. So auch jetzt: der rote Fleck im Grün nahm langsam Formen an, die ersten Grashalme waren schon deutlich zu erkennen, jetzt stand die Schärfenebene nur noch Millimeter vor dem Wild, und dann – als höbe sich ein Schleier – erkannte ich hinter den Halmen einen Fuchs, der unverwandt auf eine Stelle im Grase vor sich hinstarrte. Klapperdürr war die Fee, und wahrscheinlich hockte in ihrem Bau ein Geheck ewig hungriger Mäuler, die andauernd gestopft sein wollten. Es musste schon ein besonders großes Nest besonders saftiger Mäuse sein, die da vor ihr in der Wiese herumspielten, denn sie zog lange, glitzernde Geschmacksfäden. Beständig und mit rascher, fast ruckhafter Bewegung wandte sie ihr Haupt hin und her, hielt es bald schräg, bald grade, lauschte ihrer Beute nach, sog mit bebender Nase Wind ein, streckte das Haupt dann grade und wagrecht nach vorne, und mit blitzschnellem hohem Sprung war sie in der Wiese verschwunden, präzise mit dem Fang auf ihrer Beute landend. Ein paar zitternde Halme nur verrieten das kleine Drama – die Auslöschung einer ganzen, möglicherweise altehrwürdigen Mäusesippe – das sich da auf dem Wiesengrund abspielte. Dann war Stille.
Ein weniges später sah ich die Fee wieder, als sie mit einem fang voller Mäuse auf der ausgewalzten Fahrspur in der Wiese entlang schnürte. Sie war wirklich bemitleidenswert dürr und dünn: die Flanken eingefallen, das Fell struppig, die Lunte war schier mehr nur ein dünner Quast. Ihre Brut setzte ihr offensichtlich heftig zu und ließ ihr weder Ruh noch Fraß. Der Hunger stand ihr ins Gesicht geschrieben, als sie sich in der Fahrspur auf ihre abgemagerten Keulen niederließ um ein wenig zu rasten. Und hatte sie auch den Fang voller frischer, saftigre Mäuse, ließ ihr die Gier das helle Wasser aus dem Maul triefen: keine einzige Maus verschlang sie, mochte ihr Magen auch noch so sehr danach verlangen. Den ganzen Fang trug sie in das überwucherte Tal unterhalb der Wiese, worin ihr Bau lag und ihre Welpen der sättigenden Heimkehr der Frau Mama Ermelyne harrten, dort, auf Malepartus’ lehmigen Zinnen.
Der Abend verlief ohne weitere große Zwischenfälle – doch: ein mehr als sauberer junger Bock zeigte sich auf jener Wiese, die die jenseitige, nördliche Flanke des kleinen, verwucherten Tals – Goretex Gully geheißen - begrenzte. Zweie mochte er sein, Dreie eventuell und prahlte ganz unerträglich herüber zu mir mit dicken Stange, guter Verreckung und obszöner Höhe. Der mochte wohl und gut uralt werden, denn auf dieser Wiese war keinem Bock beizukommen. Aus Goretex Gully heraus war nichts zu wollen. Man hätte schon ein Eichkatzel sein müssen, um geräuschlos durch dieses Dickert zu kommen. Aber einen Pürschsteig dort drin freizuschneiden dazu hatte ich mich nie durchringen mögen: dieses Tal war ein völlig ungestörter, ja: unstörbarer Einstand für das Wild, und den konnte und wollte ich nicht angreifen. Von Norden her, vom alten, verfallenen Gebäude der Middle Barn, war es ein zwar schwieriges, aber machbares Herankommen. Durch einen schottrigen Hohlweg kam man von unten her, aus Westwood Valley herauf. Man musste sich den Hang zwar lautlos herauf stehen, aber das hätte sich noch hindeichseln lassen. Aber war man dann an der Wiese angelangt, war sie so verflixt kupiert und in sich überriegelnd, dass man das Wild kaum in Anblick bekommen mochte – es sei denn auf fünf oder weniger Schritt. Der Schuss von der anderen Talseite, von Fallen Tree aus, wäre unter zweihundertdreißig Metern ohnehin nicht zu machen, und das geben meine Büchsenkünste vielleicht, aber mein Schießwille nimmer er. Einen Hochstand in die Weise zu pflanzen, wie es Freund Georges immer wieder empfohlen hatte, das widerstrebt meinem Fairnessdenken.
An diesem Abend beschloss ich für mich, das Sanctuarium des Goretex Gully auf die Wiese unterhalb Middle Barn auszudehnen: da wie dort sollte das Wild fortan vor mir sicher sein und sich des Lebens in Gottes freier Natur erfreuen. Sollte mir ein Bock aber auf den Wiesen außerhalb dieses Bereiches begegnen, so wäre er – Alter und Abschussrichtigkeit vorausgesetzt – meiner Kugel frei. Ich muss nun dazu sagen, dass auf den Wiesen rund um das kleine Tal von Goretex jährlich etwelche Böcke fielen. Und so waren es immer die Schwachen und die Jungen, die ich dort erlegte. Was aber die größte Freude war für mich in all dem: auch die Gäste hielten sich an diese Regelungen. In all den Jahren seit diesem Entschluss ist im weiteren Umfeld des Goretex Gully nur ein besserer Bock gefallen, und die Umstände seiner Erlegung rechtfertigen in meinen Augen einen kleinen Abschweif vom eigentlichen Thema dieser Erzählung.
Es war auf einer guten Saujagd im Bayrischen. Der Hohe Jagdherr dort hält ehern mit der guten Sitte, in jedem Gästezimmer eine Liste der geladenen Schützen auszulegen. Natürlich war mein erster Griff auf dem Zimmer nach diesem Papier, und zu meiner großen Freude las ich dort nicht nur den Namen des Mannes meiner Schwester, sondern auch den des Sohnes dazu, meines Neffen. Mangels eigener Sprösslinge sind nun meine Geschwisterkinder die jenigen, denen ich jagdliche Förderung anbieten kann, und da mein Neffe Franz die gesamte Jagdpassion seiner väterlichen Familie geerbt hat und diese so grade zu erwachen begann, lud ich Sohn und Vater nach England ein fürs folgende Frühjahr. Er lag konvenierend in just der Woche, die ich für den Jahrlingsabschuss in England eingeplant hatte. Die ersten Tage verwandte ich vor allem darauf, für meinen Neffen einen passenden Erstlingsbock auszumachen und wandte mich dafür in die wildreichste Ecke des Reviers, jene vier beieinander liegenden großen Wiesen im Bereich von Westwood, die Georges und ich gemeinsam die „Deer Larders“, also Wildkammern getauft hatten. Da trieb sich erwartungsgemäß allerhand herum, unter anderem auch ein sichtlich alter und reifer Bock mit hochspannendem G’wichtl: links eine hochbrave Sechserstange, gut eine Handbreit über die Lauscher hinaus, rechts aber eine tief gegabelte Stange von etwas geringerer Höhe, aber an der Basis gleicher Masse wie die andere. Ich dachte zuerst an eine Bastverletzung, aber mit starkem Spektiv und ruhiger Auflage konnte ich keinerlei Perlenwucherung oder sonstige verletzungsbedingte Anzeichen feststellen. Der wäre für meinen Schwager grad der Rechte gewesen, wenn er halt nur nicht seinen Ausgang just auf der lebensversichernden Wiese zwischen Goretex Gully und Middle Barn gehabt hätte. Ich machte mir im Geiste eine Notiz und suchte weiter nach einem Neffenbock. Ich fand ihn in Form und Gestalt eines jammerschwachen Knopfers, der tagtäglich und pünktlich immer zur gleichen Stunde am obersten Spitzel von Goretex Gully in der Wiese stand, stets in Begleitung eines braven Zweijährigen. Allerdings war da weit und breit kein Sitz zu finden, und so wie der Bock stand, war auch keiner sinnvoll zu bauen. Man konnte aber recht gut an die Stelle hinpürschen und – ging man leise und vorsichtig genug – auf knappe vierzig Schritt an den Jahrling herankommen. Diese Distanz hielt ich für meinen Neffen für vertretbar zum Schuss über das stabile Dreibein. Und letztlich war’s mir auch darum, dem jungen Jäger keine mühelose Erlegung aus dem bequemen Sitz heraus zu bieten, sondern spannendes und nicht ganz einfaches Jagern und Indianern.
Ich holte Schwager Alexander und Neffe Franz in Heathrow ab und – oh Wunder – alle Gepäckstücke und Waffen kamen unversehrt, vollzählig und frühzeitig auf dem Gepäckband daher (wer die britischen Flughäfen kennt, weiß, dass das nicht die Norm ist). Wir kamen so rechtzeitig in Charlton Abbots an, dass noch genug Zeit war um Franz mit meiner Kipplaufbüchse ein paar Probeschüsse über Sandsack und Dreibein machen zu lassen. Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Die Abendpürsch ebenfalls- auch wenn sie keine Strecke brachte. Aber Franz und ich hatten im warmen Abendlicht dieses frühen Maitages eine prachtvolle Indianerpürsch hingelegt.
Von Fallen Tree her waren wir durch die Hecken gekommen, und richtig hatte der Jahrling samt seinem Erzieher zu erwarteter Zeit am erwarteten Ort gestanden: gemütlich ästen die beiden auf der anderen Seite des letzten Ausläufers von Goretext Gully herum. Das Tal kommt hier den Hang herauf und endet in einem langen, seichten Graben, die nur zum Drittel noch bewachsen ist. Genau dieser Bewuchs gab uns genug Deckung um bei gutem Wind langsam und leise heran zu kommen. Franz pürschte besser und leiser als so mancher hoch erfahrene, mit Bockmedaillen reich dekorierte Gast, den ich geführt hatte. So kamen wir recht rasch und sicher ans Tal heran. Die beiden Böcke, die ich durch die Hagdorn-Buschen im Tal gut sehen konnte, hatten kein einziges Mal aufgeworfen. Allerdings begann der kitzlige Teil der Pürsch erst jetzt, als wir am Graben angelangt waren. Von hier aus war das wild auf der anderen Seite nicht mehr zu sehen, dafür waren wir herzlich nah dran: vom Wild trennten uns noch der bewachsene Graben und vielleicht fünfzig Schritt Distanz, und wären wir endlich an der Lücke angekommen, durch die der Schuss gehen sollte, wären wir noch dreißig Schritt von den beiden Böcken entfernt. Da ist der Erfolg nur in tiefster Gangart und mit der Bewegungsgeschwindigkeit eines Minutenzeigers zu suchen. Diese paar Meter, die wir zwei da entlang getigert sind, diese wenigen Meter machen eine der schönsten Pürschen meines Lebens aus: angespanntes, jeden Schritt, jede Bewegung völlig kontrollierendes, atemraubendes, aufregendes Jagen auf kleinstem Raum war das, und jedes Mal, wenn ich hinter mich sah, blickte ich in ein vor Aufregung und Leben strahlendes Bubengesicht. Es gibt Jagderlebnisse, die sich nicht um Schuss und Tod und Trophäen drehen, aber dafür schwerer wiegen als die goldenste aller hohen Medaillen. Das war ein solches, und diese Tage sollten noch mehr und reichere derartige Erlebnisse bieten. Wir kamen ungehört und ungesehen an die Schusslücke heran, aber von unseren beiden Böcken sah ich nur noch einen Spiegel gemessenen und vertrauten Schrittes im Dickicht von Goretex Gully verschwinden. Es hatte nicht sollen sein.
Wir versuchten meines Neffen Glück am nächsten frühen Morgen an anderer Stelle, und von einem Bodensitz unterhalb einer verkrauteten Wand schoss Franz sein erstes Stück Wild, einen Fuchsrüden, der durchs taunasse Gras dahergeschnürt kam. Fast hätte es zu einem Muntjak-Böckchen gelangt, aber als Franz den Stecher gehen ließ, sagte das Gewehr lediglich „Klack!“. Der junge Schütze hatte alles richtig gemacht, inklusive Lösen der Sicherung. Nur hatte ihm sein tepperter Onkel eine ungeladene Büchse gereicht! Während ich mit einem wenig intelligenten Gesichtsausdruck in den Cotswolds stand und mein Schwager sich das Lachen nur mühsam verbeißen mochte, kam’s vom Neffen: „Dürfte ich jetzt bitte eine Patrone haben? Da vorn ist ein Fuchs!“. Heute hängt besagter Fuchs in seinem Zimmer: ein in der Nähe von Charlton Abbots lebender Taxidermist hat Haupt und Vorschlag des Rüden in alter viktorianischer Manier mit aufgerissenem Rachen und gefletschten Fängen gar wunderbar präpariert, und zu Weihnachten ging ein entsprechendes Paket an den Schützen. In dem Paket lag aber noch ein weiteres Haupt, und von dessen Erlegung will ich kurz berichten.
Zur Abendpürsch wollten wir noch einmal nach dem Knopfer an Goretex Gully sehen. Der Wind hatte gedreht, und so packten wir die Sache diesmal von Norden her an. Der Weg führte uns mitten durch die Deer Larders, und als wir arglos, ungedeckt und unjagdlich laut miteinander schwatzend mitten auf der Wiese standen, sah ich an der Hecke, die Larder eins von Larder Zwei trennt ein Reh im Gras niedergetan. Der Blick durchs zehnfache Pürschglas ließ es mir siedheiß durch den Leib fahren: das war eben der Abnorme, den ich im Geiste für meinen Schwager vorgemerkt hatte! Recht weit von seinem Einstand saß er da im Schatten der Hecke und drückte behaglich das frischgeäste junge Grün der Wiesen nach. Allerdings war er nicht nur recht weit von seinem Einstand, sondern auch recht weit von uns weg, und obendrein würde der Schuss auf ihn mit Sicherheit den Knopfer, der wenn, dann in der nächsten Wiese stand, für diesen Abend nachhaltig vertreiben. Ich schilderte meinen beiden Jägern die Situation. Mein Neffe überlegte keine Sekunde: „Natürlich schießt der Papi den Bock! Den Knöpfler probieren wir dann morgen.“
Im Gesicht meines Schwagers war eine interessante Mischung aus väterlicher Rührung, Stolz, Jagdpassion und Verlegenheit zu sehen: dass sein Sohn eine Chance auf seinen ersten Bock dreingab, das rührte ihn an. Dass er den Abnormen wollte, das war ebenfalls deutlich. Aber der Schuss da hinüber war junge 150 Meter weit. Ans Schieße übers Dreibein war er von Namibia und Südafrika her gewohnt, aber vor solchem Publikum und in solcher Situation kommt unweigerlich die Angst vor der Blamage auf. Er schenkte mir einen schicksalsergebenen Blick und nahm seinen Stutzen von der Schulter. Ich richtete ihm das Dreibein auf, der Abnorme erhob sich, bekam keine Sekunde später die Kugel und begab sich krummen Rückens der Szenerie. Der Schuss saß weich.
In der Situation gab es wenig Zeit zu verwarten: der Bock war durch die Hecke vor uns geschloffen, und es stand anzunehmen, dass er über die nächste Wiese in seinen Einstand in Goretex Gully flüchten würde. Und ihn dort herauszusuchen, das wäre ein schindiges Stück Arbeit mit wenig Aussicht auf Erfolg in diesem undurchdringlichen Dornendschungel gewesen. „Lauf vor zur Hecke und schau, ob Du ihn auf der Wiese noch erwischt!“ Alexander packte die Waffe im Schwerpunkt und rannte los. Franz sah mich an: „Wenn er will, kann er ja schon ganz schön schnell laufen, der Papi.“
Nach mehreren Minuten krachte ein erneuter Schuss, wenig später kam Alexander wieder durch die Hecke und zu uns herunter: er hatte den Bock noch einmal an einer Hecke gesehen, aus freier Hand hingeschossen, das Wild sei daraufhin in der Hecke verschwunden. Getroffen habe er nicht, da sei er sich sicher. Ich ließ mir die Stelle genauer bezeichnen und wusste: weit würde der Bock nicht gekommen sein. Wir gingen selbdritt in die nächste Wiese hinein, mein Schwager zeigte mir von fern die Stelle, an der er den Bock beschossen hatte. Der Bock hatte sich just die Lücke ausgesucht, in der noch ein Stück festen Schafzaunes stand! Nach wenigen Schritten schon sahen wir das Wild im Gras liegen, der Bock war verendet. Die Krone war so, wie ich sie im Spektiv angesprochen hatte, und die rechte, abnorme, tief gegabelte Stange zeigt tatsächlich die Anlage echter Dreistangigkeit: bis zur Rose hinunter sieht man, dass da eigentlich zwei Stangen an der Basis zu einer verschmolzen sind und sich alsbald wieder voneinander trennen. In meinem Bildarchiv findet sich ein Photo von der Strecke dieses Bockes, Vater und Sohn sitzen daneben, und der Sohn strahlt fast mehr als der Vater. Mir selbst war die Erlegung doppelte Freude: zum einen freute mich das Waidmanns Heil meines Schwagers, zum anderen die Tatsache, dass endlich einmal einer der guten Böcke von jener Wiese zwischen Goretex Gully und Middle Barn zur Strecke gekommen war – wenn auch nur aus dem Grunde, dass er sich ein aus seiner sicheren Heimstatt zu weit herausgewagt hatte.
Aber kehren wir von diesem kleinen Ausflug zurück an den Ausgangspunkt dieser Geschichte: die Fuchsfee mit dem einen Gehör. Ich ging an dem Abend etwas nachdenklich über die Hügel zum Haus. Ich bewunderte diese Füchsin, die klappermager einen Fang voller frischer Mäuse unangetastet ihren kleinen Quälgeistern zugetragen hatte. Und ich beschloss im Stillen, am nächsten Morgen wieder auf diese Wiese zu gehen. Vielleicht würde ich die Füchsin ja erneut zu Gesicht bekommen. Als ich anderntags im Frühdunst aus dem Tal von Westwood hinauf auf die Wiese von Fallen Tree pürschte, war meine Füchsin nicht zu sehen, aber dafür drei ihrer nächsten Verwandten: zwei saßen geduckt vor engen Durchlässen in den Hecken, in die vielbelaufene Hasenpässe führten, ein dritter, ein starker Rüd, mäanderte gemächlich und rotprahlend durch die Wiese. Ich habe dieses Verhalten mehrfach beobachtet und mich immer gefragt, ob die vorherrschende Lehrmeinung, dass der Fuchs allein lebe und jage, wirklich richtig sei. Ich habe aufgrund meiner Beobachtungen immer an der Richtigkeit dieser These gezweifelt, und der britische Wildbiologe David Macdonald beschreibt es in seinem wunderbaren Buch „Running with the fox“: Füchse leben und jagen in Familiengruppen. Sie treiben sich auf die eben beschriebene Weise das Wild gegenseitig zu, und ein Hase oder Kanin, das einen Fuchs auf der Wiese schnüren sieht, wird sich schleunigst auf dem Wechsel in Sicherheit begeben – um dann gegebenenfalls im Fang eines anderen Fuchses zu landen.
Die drei Füchse in der Wiese dieses Morgens ließen sich von meinem Erscheinen wenig beeindrucken, und ich bin der festen Überzeugung, dass sie wussten, dass ihnen von mir kein Unheil droht. Oft und häufig sehe ich, pürsche ich allein durchs Revier, Füchse beim Mausen, auf der Jagd nach Regenwürmern oder Kerfen. Oft schaue ich ihnen zu, wenn sie auf den Fahrspuren in der Morgensonne fletzen, sich den Balg trocknen lassen, zuweilen dabei herzhaft gähnen, die Glieder strecken und dann weiter schüren, hier eine Schnecke verspeisend, dort einen saftigen Käfer. Mehrfach habe ich beobachtet, dass sie an Fasanenhennen samt Gesperr mit schier gegraustem Gesichtsausdruck vorbeigehen, als wollten sie sagen: „Nicht schon wieder Fasan!“. Und tatsächlich gibt es deren in diesem Revier helle Massen, denn der Jagdherr führt auf seinem Besitz eine kommerziell betriebene Fasanenjagd, und alljährlich wird eine große Zahl von jungen Vögeln im Juni in die Volieren gesetzt. Dem allgegenwärtigen kerngrünen Waidgerechtling will ich dazu nur sagen, dass der jetzt sicher schon auf den Lippen liegende Begriff „Kistenfasan“ hier nicht passt, denn diese Volieren werden geöffnet, sobald die Vögel ausgefiedert sind, und so sind die Fasanen, die dann im Winter geschossen werden, in meinen Augen als Wild zu sehen. Diese Methode ist in Deutschland aus Gründen, deren angebliche Richtigkeit ich hier nicht diskutieren möchte, verboten. Ich für meinen Teil genieße es, dass es in Charlton Abbots Fasanen sonder Zahl gibt und erfreue mich an ihrem Anblick. Allerdings mache ich bei der Bejagung des Fuchses – „Charlie“ nennen ihn die Engländer – nicht mit. Denn wie beschrieben geht meiner Beobachtung nach Charlie bei weitem nicht so heftig an den dortigen Niederwildbesatz, wie es sonst immer gesagt wird, und zum anderen: die Zahl der Vögel, die sommers ausgewildert wird, bleibt Jahr für Jahr gleich, und es werden bei weitem nicht alle davon auf den Jagden geschossen. Warum man dann den Füchsen den Überfluss, an dem sie ohnehin zur zu Teilen partizipieren, missgönnt, entzieht sich meinem Verständnis und Begriff.
So lasse ich die Füchse in Ruhe und beobachte sie lieber. Sie wissen das und lassen mich gewähren. Komme ich aber mit einem Jagdgast im Schlepptau des Weges, sehe ich nur noch Luntenspitzen, die in den Hecken verschwinden.
Der Fuchsrüde von Fallen Tree, der an diesem Morgen offenbar als Treiber für die beiden anderen fungierte, ließ mich gut fünfzig Schritt an sich vorüber ziehen und duckte sich noch nicht einmal ins Gras. Blickte mir nur ein Weilchen hinterher und mäanderte dann weiter durch die Wiese, immer auf Sichtbarkeit und Wirkung bedacht. Ich bezog mein Bodensitzel am gefallenen Baum, lehnte die Bin ins Eck und steckte mir ein Morgenpfeiflein an. Es gibt mir wenig schöneres als einen solcherart begangenen Frühlingsmorgen: Dunst und Kühle heben sich mählich, die Sonne schickt erste wärmende Strahlen herab, die Sträucher in den Hecken stehen in voller Blüte, das frische Gras hat diesen fett smaragdenen Ton von Leben und Frische. Alles duftet neu und jung, ja, selbst der Wind in den Bäumen klingt weicher als im Winter. Und wenn dann in all dieser Morgenpracht ein passender Abschussbock daherkommt, dann wird die ganze Szenerie vollends zum Gesamtkunstwerk: dann mischt sich zu Optik, Olfaktorik und Akustik noch die Kulinarik, und ich freue mich auf ein Frühstück mit frischer Rehleber. Der Knopfspießer war bequem den Hang herauf gebummelt bekommen, und als er querab auf siebzig Schritt verhoffte, warf ihn die Kugel direkt in bessere Gefilde. Ich barg den Bock und zog ihn zum Weg. Dann holte ich das Auto, um die Beute zur Versorgung in die Wildkammer zu bringen. Als ich den Jahrling in die Wildwanne wuchtete, fiel mir die klapperdürre Fee wieder ein, und ich beschloss, ein mildtätiges Werk zu verrichten. Anstatt in der Wildkammer brach ich den Bock an Ort und Stelle auf, behielt die Leber fürs Frühstück und legte den Rest des Aufbruchs am Buschsaum des Goretex Gully ab. Sollte sich die Füchsin ordentlich satt fressen daran, und für ihre Welpen wäre dann immer noch genug da. Und richtig: als ich am frühen Nachmittag wieder an der Stelle vorbeikam, war der Aufbruch weg, und in der Schleifspur standen die Fährten eines erwachsenen Fuchses und mehrerer Welpen.
Pürsch und Nachschau der nächsten Tage führte mich in andere Revierteile, brachte Anblicke, Erlegungen und wunderbare Stunden in den Wiesen und den Wäldern. Aber so schön auch die Momente auf Coles Hill, in Bespidge, Sidelands oder Spoonley waren: die Füchsin aus dem Goretex Gully ließ mir keine Ruhe. Mochte es Bewunderung sein oder pure Sentimentalität – und wahrscheinlich war es eher Letzteres denn Ersteres: ich merkte, wie ich bei jeder Pürsch und jedem verhockten Viertelstündlein erwischte ich mich dabei, dass ich die Szenerie mit meinem Glas intensiv nach diesem so typisch asymmetrischen Haupt absuchte. Anfänglich tat ich das Alles noch als gefühlsduselige Spinnerei ab und schalt mich einen Narren, der das Wild zumindest gedanklich domestizierte. Und ich gebe gerne zu, dass es in meiner frühen Schulzeit ein bestimmtest, dahingehendes Erlebnis gab, das mich damals unsagbar fesselte und heute noch klar und deutlich in der Erinnerung abrufbar ist.
Es war im ersten Jahr meiner österreichischen Schulzeit, und ich war in dem Internat kreuzunglücklich. Ich hätte mir zwar eher die Zunge abgebissen, als dass ich meinen Eltern davon erzählt hätte, aber – nun ja: eine schöne Zeit war das nicht. Einen großen Lichtblick aber gab es in diesem Jahr: der Österreichische Rundfunk suchte damals Schulklassen, die zu bestimmten Themen Radiosendungen machen sollten. Meine Klasse hatte sich beworben und war akzeptiert worden: wir hatten ein Portrait des großen Verhaltensforschers Konrad Lorenz in Aussicht gestellt, der damals seine Forschungsstation in Grünau am Almsee hatte. Es war faszinierend, diesen großen Mann und seine Arbeit mit seinen Graugänsen zu sehen und ihn tatsächlich zu erleben, zu sprechen und zu interviewen. Aber für mich war ein anderer Moment an diesem Tag herausragend: Lorenz war mit meinem Großvater gut bekannt, und als wir uns vorstellten, sah er mich einen Augenblick länger an als meine Schulkameraden – zumindest bildete ich mir das ein. Als die Aufzeichnung der Sendung beendet war und wir uns den Wildpark auf der Forschungsstation genauer ansehen durften mit seinen Wisenten, Wildpferden, Fischottern und Wölfen legte sich irgendwann eine schwere Hand auf meine Schulter. Ich drehte mich um und blickte in das gütige, weißbärtige Gesicht des Forschers: „Komm einmal mit, ich will Dir etwas zeigen.“ Lorenz führte mich an eine Stelle des Wildparks, wo er zaunlos in den Wald der Cumberland-Stiftung überging: „Jetzt pass auf!“ Lorenz keckerte in den Wald hinein, und Sekunden später kam unter ebenso lautem Gekecker eine Fuchsfee auf ihn zugerast, deren ganze Körpersprache wie bei einem Hund allergrößte Freude signalisierte. Lorenz breitete die Arme aus, und aus drei Metern Entfernung flog die Fee den Forscher an. Er hielt sie in seinen Armen und sie leckte ihm das Gesicht. Ich stand starr, völlig verzaubert daneben und sah atemlos zu, wie der Fuchs sich an den Mann drückte, mit hochgezogenen Lefzen über das ganze Gesicht lachte und sich von ihm streicheln ließ. Wie in Trance streckte ich meine Hand aus, denn um alles in der Welt wollte ich dieses Tier berühren. Doch meine Finger waren noch nicht einmal in der Nähe des Tieres, da drehte die Fee ihr Haupt zu mir, legte die Gehöre an, kniff die Seher zusammen und fauchte aus Leibeskräften auf mich hin. „Sie lässt sich nur von mir anfassen, von anderen mag sie das nicht“, sagte der Forscher.
Als die Fee nach ausgiebiger Begrüßung wieder aus den Armen von Konrad Lorenz in den Wald gesprungen war, erzählte er mir, wie er das Tier als noch blinden Welpen bekommen hatte. Wie genau das zugegangen war, das weiß ich heute nicht mehr genau. Ich glaube mich zu erinnern, dass das Muttertier überfahren oder sonst wie zu Tode gekommen war und ein Berufsjäger das verwaiste Geheck ausgehoben und zu Lorenz in die Forschungsstation gebracht hatte. Die Geschwister waren sämtliche eingegangen, nur die Fee hatte überlebt, Lorenz hatte sie aufgezogen und auf sich geprägt. Die Fee lebte mehrere Jahre völlig wild im Wald hinter der Station, hatte aber ihre „Ziehmutter“ nie vergessen und kam stets auf seinen Ruf. Bis heute lässt mich dieses Erlebnis nicht los, diese enge Beziehung von Wildtier und Mensch, und viele Nächte habe ich als Schulbub im Internat davon geträumt, auch eine solche Freundschaft mit dem Wild haben zu dürfen. Ein Wunschtraum, der – wenn ich ehrlich bin – eigentlich immer geblieben ist. Und einer, der für mich und vor mir selbst in keinem Widerspruch zur aktiven Jagdausübung steht.
Am letzten Abend vor meiner Abreise aus Charlton Abbots kam ich in letztem Licht noch einmal über die Wiese von Fallen Tree gebummelt. Es war kein rechtes, zielgerichtetes Pürschen mehr, eher ein auf den Wiesen so vor mich Hingehen, heiteren und nichts suchenden Sinns. Der Jahrling stand halt da, breit, schwach und passend. Den Aufbruch ließ ich wie schon einige Tage zuvor unterm Strauchtrauf am Gully liegen. Als ich den Jahrling den steilen Hohlweg ins Tal hinunter zog, war es mir, als wäre da ein roter Schatten zum Aufbruch gehuscht mit seltsam asymmetrischem Haupt.
In London warteten neben der besten Ehefrau und meinen beiden Hunden auch volle Schreibtische sowohl im Büro als auch im Studierzimmer auf mich. Die Arbeit wurde trotz in Angriffnahme leider nicht weniger, sondern eher mehr. So waren es nur Gedanken, die mich ins Revier trugen über die nächsten Wochen und schließlich Monate. Regelmäßiger Briefverkehr und gelegentliche Telefonate mit meinem Freund Georges hielten mich über die Geschehnisse im Revier auf dem Laufenden, und immer wieder flocht ich in unsere Konversationen die Frage ein, wie der Headkeeper mit der Fuchsbejagung nachkäme. Irgendwann musste das auffallen: ich, der ich nie einen Fuchs in Charlton Abbots geschossen hatte oder hätte schießen lassen, ich erkundigte mich mit einem Mal regelmäßig nach diesem Teil der Revierarbeit. Als Georges dann endlich einmal dem Grund dieser unerwarteten Neugier fragte, redete ich mich mit allgemeinem Interesse an allen Dingen, die im Reviere vor sich gingen, heraus. Den eigentlichen Grund, nämlich die Angst von der Erlegung einer einohrigen Fuchsfee zu erfahren, den verriet ich natürlich nicht. Auch schien mir meine Bekannte vor den Nachstellungen des Keepers relativ sicher zu sein: die erstreckten sich auf den näheren Umkreis der Volieren und entlang seiner Fahrtrouten durchs Revier. Solange die Fee sich auf Goretex Gully und die Wiesen von Fallen Tree und Middle Barn beschränkte, sollte ihr wenig geschehen. Dort kam der Keeper so gut wie nie vorbei. Aber auf der anderen Seite von Westwood Valley war eine der größten Volieren des Reviers, und direkt an Fallen Tree grenzten Wald und Wiese von Bee’s an – und das war einer der guten Fasanentriebe. Wollte ich mir auch einreden, dass das nun mal das Lebensrisiko eines Fuchses auf einer intensiv betriebenen Flugwildjagd sei: es gelang mir nicht so recht. Nicht wissend, ob es im Heiligenkanon einen für die Füchse zuständigen Heiligen oder Nothelfer gibt, empfahl ich die Fee der Obhut des Hl. Franziskus und wartete ungeduldig die Blattzeit und meine Fahrt nach Charlton ab.
Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, mich von meiner – so wollte ich das betrachten – Sentimentalität nicht weiter belästigen zu lassen und die Gegend um Fallen Tree erst wieder aufzusuchen, wenn sich dort die Blatterei auf einen erntereifen Bock bot. Aber Ausreden finde ich auch vor mir selbst rasch: es müsste doch irgendwie hinzudeichseln sein, dass ich den guten, wohlvereckten und hochstangerten Bock von Middle Barn irgendwie vors Blatt bekäme – und vielleicht auch vor die Büchse. Denn als ich ihn im Frühjahr auf weite Distanz als bestenfalls mittelalt angesprochen hatte, da war er doch recht weit weg gewesen, und das Licht war auch nicht wirklich gut gewesen an diesem Abend, und überhaupt ist ein Rehbock schnell falsch angesprochen. Möglicherweise war er doch alt?
Sinnvoll wäre es gewesen, unterhalb der Wiese im Stangenholz zu blatten. Aber ich machte aus sehr durchsichtigen Gründen eine lange Pürsch durch Bee’s und über die Wiese von Fallen Tree. Als ich bei Middle Barn anlangte, stand der Wind erwartungsgemäß schlecht, und ich bummelte derhalben den gleichen Weg zurück. Meine Freundin bekam ich nicht zu Gesicht. Ich schob es auf das hohe Gras. Den Keeper traf ich am nächsten Vormittag, als ich einen Bock, den ein Mitjäger erlegt hatte, aus der Decke schlug und grillfertig machte. Wie immer gab es den üblichen kleinen Chat über dieses und jenes und eine beiläufige Frage, was Charly und Konsorten denn so trieben: „Ganz schlechtes Jahr dieses Jahr. Wir haben mit Mühe und Not drei oder vier Füchse erwischt bisher. Alle drüben in Bespidge.“ Ich rechnete kurz im Kopf nach: von Fallen Tree und Goretex Gully hinüber nach Bespidge waren es gute drei Kilometer wie die Krähe fliegt. Der Fuchs mäandert nun ganz anders, und in diesem reich besetzten Revier wohl kaum über diese Distanz. Ich wandte mich kurzfristig wieder meinem Zerwirk-Werk zu, um die Erleichterung über diese Nachricht nicht allzu deutlich in meinem Gesicht lesen zu lassen.
Jetzt, wo ich sicher sein konnte, dass der Fee zumindest von Seiten des Berufsjägers nichts geschehen war, wollte ich sie natürlich wiedersehen. So suchte ich nach jedem erdenklichen Vorwand, um meine Wege in ihren Gewann zu führen. Selbst den ein oder anderen Jagdgast schleifte ich über die dortigen Wiesen – mit wenig Aussicht auf Erfolg für den Gast, aber zumindest mit der Chance für mich, meine Bekannte in Anblick zu bekommen. Es gelang nicht. Generell bekam ich wenig Füchse in Anblick, und die Gegend um Fallen Tree schien, was die Familie Reynard anging, völlig entvölkert. An sich war die Blattzeit erfolgreich: die Gäste brachten einige hochpassable und zum Teil sehr gute Böcke zur Strecke, mir selbst begegnete in Oxleaze ein ausnahmsguter und für lange Zeit mein bester Bock aus Charlton Abbots, von dem an anderer Stelle noch zu berichten sein wird. Aber als ich zurück nach London fuhr, fehlte im Bilderbogen der Erlebnisse ein Bild, und diese Leerstelle ging mir auf bestimmte Weise näher, als ich mir das selbst zugestehen wollte.
Im frühen Jahr kam ich wieder in die Cotswolds, es ging darum, den ersten großen Gaissenriegler vorzubereiten. Eine Woche Zeit hatten Georges und ich uns dafür genommen: die Triebe waren festzulegen, die Stände auszuwählen und einzurichten, und ein wenig Pürscherei auf Gaiss und Kitz war auch geplant. Wenig Wunder, dass mein erster Gang über Fallen Tree führte. Als ich von Bee’s her durch die Hecke kam, glaste ich die Fläche Meter für Meter ab, in der Hoffnung, das Haupt meiner Fee zu entdecken. Sie war nicht zu sehen, dafür aber standen Gaiss und Kitz ganz unten in dem Eck, das Goretex Gully und die Hecke zur nächstgelegenen Wiese bildeten. Ich schlich mich außer Sicht an den oberen Rand der Wiese, um so in der Überriegelung zum Wild auf Höhe des Bodensitzes beim umgestürzten Baum zu kommen. Dort konnte ich mit gewissem Sichtschutz stichgerade zum Sitz gelangen und – sollte das Wild ausgehalten haben – einen Schuss auf das Kitz loswerden. Es gelang, und es gelang übergut: das Kitz fiel im Knall, die Gaiss sprang aber nicht wie erwartet ins Dickicht des Gully ab, sondern ging im Stechschritt sichtlich alertiert auf und ab. Wahrscheinlich hatte das Eck, in dem sie stand, den Schusshall so verworfen, dass sie das Ereignis nicht sofort zuordnen konnte. Jedenfalls gab sie mir genug Zeit, meine Kipplaufbüchse erneut zu laden und einen zweiten, abermals erfolgreichen Schuss zu tun. Solche Gaiss-Kitz-Doubletten sind mir – speziell mit meiner ejektorlosen Ferlacher Einschüssigen – selten gelungen. So war ich recht zufrieden mit Pürsch und Erfolg.
Ich trat nach einigen Andachts- und Dankminuten ans Wild, gab Letzte Bissen und Bruch und machte mich ans rote Werk. Das Kitz lag nach einigen Minuten aufgebrochen da, und als ich mich an der Gaiss zu schaffen machte, hatte ich das untrügliche Gefühl, dass mir jemand zusehe. Man kennt das: die Blicke, die sich da in den Rücken bohren, sind körperlich spürbar. Georges konnte es kaum sein, der weilte in einem gänzlich anderen Revierteil. Ich wandte mich um, ob da ein Spaziergänger oder der Keeper stand, aber die Fläche war leer. Ich machte mich wieder an die Arbeit, aber der Eindruck des intensiv Beobachtetwerdens blieb. Da kam mir der Gedanke. Konnte, sollte womöglich? Ich drehte mich abermals um, sehr viel langsamer und behutsamer diesmal und sah nicht auf die Wiesenfläche, sondern äugte die Kante von Gras zu Strauch ab. Auf fünfzehn Schritt saß sie da: hoch aufgereckt, das eine Gehör nach vorne gewandt, den Fang leicht geöffnet. Dann hob sie leicht das Haupt, und ich blickte in ihre Seher. Die Fee duckte sich leicht ins Kraut und machte – ja, man verzeihe mir bitte nun diesen eher kynologischen Ausdruck – Platz, und zwar genau so wie meine Hunde, wenn ich ihnen beim Essen mit scharfer Stimme sage, dass niemand bettelnde Hunde schätze: die Vorderbranten lang und parallel ausgestreckt, das Haupt hoch, mit wachem Blick und glitzernden Lefzen. Die Fee bettelte nicht, nein, sie wartete geduldig darauf, ob dieses seltsame zweiläufige Wesen da vor ihr wieder einmal Fraß da ließe. Ich ließ, und reichlich.
Allerdings befand ich mich nun in einer gewissen Zwickmühle: so sehr ich mich darüber freute, dass meine Freundin lebte, wohlauf war und sich obendrein ganz offensichtlich meiner als Freund erinnerte, so hatte ich nun doch wie Stück Wild liegen und wenig Lust darauf, beide gleichzeitig zum nicht unbedingt nahe stehenden Auto zu buckeln. Die beiden Stücke mit einem Taschentuch oder einer abgeschossenen Patronenhülse zu verstänkern, wie es das Lehrbuch vorschreibt, erschien mir ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen, denn die Fee zeigte vor dem Geruch des Menschen und seiner jagdlichen Paraphernalien deutlich weder Furcht noch Respekt. Was tun? Mir blieb letzten Endes keine andere Wahl, als mich auf die Hoffnung zu verlassen, dass es auch zwischen Fuchs und Mensch generellen Anstand und gute Sitten gibt. Ich drehte mich langsam zur immer noch wachsam daliegenden Fee um, die ihre Seher unverwandt auf den Aufbruch geheftet hielt und sagte mit halblauter Stimme: „Sei bitte so anständig und lass mein Essen in Ruh, ich hab Dir weiß Gott genug für Dich hingelegt.“ Dann lud ich mir die Gaiss auf und brachte sie zum Auto. Die Fee drückte sich lediglich ein wenig tiefer ins Kraut, nahm ihren Blick keinen Sekundenbruchteil vom Aufbruch und ließ mich auf wenige Schritt an ihr vorbeigehen. Als ich wenige Minuten später zurückkehrte, saß die Fee am Aufbruch und tat sich mit hörbarem Behagen gütlich daran. Als sie mich kommen hörte, schrak sie zusammen und sprang mit einem großen Satz seitwärts ins Gebüsch. Dort deckte sie sich notdürftig hinter ein paar Grashalmen und ließ ihre „Beute“ nicht aus dem Blick. Das Kitz war von ihr nicht berührt worden, die drei, vier langen, trockenen Grashalme, die ich darüber gelegt hatte, waren nicht verrückt worden. „Gutes Mädel!“. Mit diesen Worten nahm ich das Kitz auf und ging reich an Beute, noch reicher an Erleben, meines Wegs. Nach einigen Schritten wandte ich mich um. Die Fee saß wieder auf dem Luder, drehte nun ihrerseits sich um, und für einige Sekunden sahen wir uns an. Man soll und darf Wild nicht vermenschlichen. Aber ich glaube, dass in meinem wie in ihrem Blick so etwas wie gegenseitige Achtung lag.
In den nächsten Tagen sah ich sie öfter: entweder beim Mäusefang auf der Wiese, hin und wieder dösend auf einem der raren Sonnenfleckchen, am letzten Tag vor dem Riegler in wildem Tanz mit einem Rüden. Ranzzeit. Für morgen war mir nicht bang um sie – Jagdherr Tristan, großer Reiter und Huntsman, zeitweise gar Joint Master of the Cotswolds Hunt, hatte über die Füchse Schonung ausgesprochen, damit die berittene Jagd nicht ums Wild gebracht würde. Ich lobte ihn und seine gütige Weisheit im Stillen, denn die Jagd führte, wenn sie über Tristans Land ging, am anderen Ende des Reviers durch und berührte den ganzen Komplex von Westwood nie.
Seit diesen Tagen ließ ich von jedem Stück, das ich auf den Wiesen meiner Fee schoss, den Aufbruch für sie liegen. Sie lohnte es mir mit Vertrauen. Kam ich des Weges, blickte sie kurz auf und ließ mich dann passieren, kam sie des Weges, setzte sie sich auf die Keulen, blickte zu mir her, spielte wie zum Gruß mit dem Gehör und ging dann in aller Ruhe und Vertrautheit ihrer Wechsel. Manchmal sah ich sie, wenn sie auf Treibjagd im Verband ihrer Familiengruppe an einem Heckendurchlass saß und auf von den anderen zugedrückte Beute lauerte – als Treiberin sah ich sie nie. Und im späteren Mai zeigte sie mir gar einmal ihr Geheck und ließ die junge Brut vor mir im Gras paradieren. Ich fühlte mich geehrt und geschmeichelt.
Einige Wochen später allerdings gab es ein Erlebnis, das mich tief berührte. Ganz gegen Tradition und Gewohnheiten war ich im Juni für ein längeres Wochenende ins Revier gekommen. Der Jahrlingsabschuss im Mai war wegen schlechten Wetters beklagenswert untererfüllt. Und ging es auch schon auf die Feiste zu: für dieses Jahr standen einige gute Ernteböcke an, und ich wollte mir das ohnehin zähe Blatten im hohen Gras nicht durch ein Zuviel an präpotenten Jünglingen stören lassen. Dennoch war’s leichter gesagt als getan: das Wild wurde schon hübsch heimlich, und hatte ich Anblick, dann waren es keine passenden Jahrlinge. Ich tigerte reichlich erfolglos umher, ich saß mir den Hintern platt – es war wie verhext, oder besser gesagt, wie üblich um diese Jahreszeit: kaum Wild zu sehen, wenn, dann nur kurz, meist mittelalt, kaum ein Alter, gar kein Jahrling. Aber ich war nun einmal hier, unverrichteter Dinge oder gar vorzeitig abzureisen kam nicht in Frage. So pflockte ich eines späteren Nachmittages mit ausreichend Tabak und Lesestoff versehen auf meinem Bodensitz am umgestürzten Pappelstamm und genoss Freiheit, Sonne, generell die ganze Atmosphäre von Fallen Tree. Ich hatte gute Muße , die einsehbare Fläche blieb wildleer. Wäre ich noch so voll frischer Passion gewesen wie am Tag meiner Ankunft, hätte ich mich sicherlich das ein oder andere Mal umgewandt und die Hecken hinter mir abgeglast. Aber ich war durch die Misserfolge der vorangegangenen Pürschen und Ansitze – nun ja – ein wenig frustriert, und da wird der Mensch nachlässig und schlampig. Abgesehen davon war es ein wirklich gutes und spannendes Buch, das ich da in Händen hielt. Seite um Seite führte ich mir zu Gemüt und vergaß dabei mehr und mehr auf Wild und Welt.
Irgendwann sah ich dann aber doch einmal auf, und mein Herz ruckte freudig: brettbreit hockte meine eingehörige Fee auf der Wiese. Gut sah sie aus, der Balg saß straff und glänzte in der Abendsonne, das eine Gehör spielte hin und her. Mit leicht geöffnetem Fang hockte sie auf ihren Keulen und sah über vierzig Schritt zu mir her. Das heißt: nein. Sie sah nicht her, sie sah mich an, unverwandt, reglos und vertraut. Man halte mich nun meinethalben für sonderlich, doch mir ging der Blick der Fuchsfee durch und durch. Mag sein, dass sie frischen Aufbruch sich von mir erhoffte und wenig erbaut darüber war, dass ich es am jagdlichen Eifer mangeln ließ, mag sein, dass ich mich ertappt fühlte dabei, dass ich ein schnödes Buch las anstatt die Bände der Natur zu studieren. Sei dem wie es sei, ich nickte wie zur Bestätigung des unausgesprochenen Vorwurfs, klappte das Buch zu und nahm das Glas zur Hand. Dass auf den Wiesen vor mir bis zum Gully und drüben bei Middle Barn kein Reh zu Wege war, das konnte ich auch mit freiem Auge sehen. Aber wer gefehlt hat, der versucht halt, durch ostentatives Bemühen die Scharte wieder auszuwetzen. So glaste ich brav Halm für Halm und Strauch für Strauch ab, nahm dann das Glas wieder von den Augen und warf meiner Fee einen Verzeihung heischenden Blick zu. Sie hielt mich weiter im Blick, beugte dann mit einem Mal ihr Haupt, reckte den spitzen Fang vor und wandte ihn dann langsam zu ihrer Rechten, meiner Linken hin. Nahm ihn dann wieder gerade und hob das Haupt wieder, nur um es nach wenigen Sekunden wieder zu senken und nach rechts zu wenden. Dieses Spiel trieb sie drei oder vier mal. Dann begriff ich. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber die Fee deutete unmissverständlich zur Hecke dreißig Schritt zu meiner Linken, deren breiter Durchlass in die nächste Wiese führte. Leichter Wind stand von dort her.
Bei aller offen eingestandenen Sentimentalität, die mich dem Wild gegenüber zuweilen befällt, kam ich mir jetzt doch ein wenig seltsam vor. Sollte die Fee Witterung von etwas für sie erstrebenswert Essbarem aufgenommen haben, von etwas, dass für sie zu strecken zu groß war, dessen Erlangung sie nun von mir erhoffte? Das war nun doch ein wenig zu sehr Kitsch en facon Disney. Aber die Fee deutete wieder und immer noch zum Durchlass und zur Hecke hin. „Was soll’s?“, sagte ich mir. Ich konnte nun hier hocken bleiben und dem Fuchs weiter zusehen, oder ich konnte bei gutem Wind und bester Deckung an die Hecke pürschen und einen raschen Blick durch den Durchlass tun. Das war nun grad schon Rock wie Hose. Ich nahm meine Büchse und das Dreibein und machte mich auf den Weg.
Hinüber zur Hecke war es kein Kunststück. Aber die letzten Schritte zum Durchlass und dort hinein, das wollte langsam und übervorsichtig unternommen sein. Blickt man von der anderen Seite, von der dortigen Wiese aus auf den Durchlass, dann ist er ein heller Fleck im Dunkel des Strauchwerks, und besonders Rehwild als Bewegungsseher erkennt sofort jede Änderung dieser hellen Stelle auch noch aus dem letzen Winkel seiner Lichter. Minutenzeigerlangsam schob ich mich vor. Jetzt wurde das Blattwerk der Hecke langsam licht, das Grün der Wiese schimmerte schon hindurch, und in diesem Grün stand ein unverkennbarer, hellroter Fleck. Mir gab’s einen siedheißen Riss mittendurch, und mich packte das Jagdfieber. Das Reh hatte das Haupt unten und äste sich von mir fort. Ich nahm die Büchse von der Schulter, klappte das Dreibein auf, hielt es mit der rechten Hand unterm Vorderschaft fest und schob mich so zum schnellen Schuss bereit weiter in die Lücke hinein.
Der Bock – sein Spiegel verriet ihn als solchen – war so mit dem Äsen beschäftigt, dass ich nicht nur den Durchlass, sondern sogar die andere Seite der Hecke gewann, dort drei Schritt zur Seite tun konnte und nun mit meiner Tarnjacke gut gedeckt gegen den Hintergrund der Hecke Stellung beziehen konnte. Bock ja, soviel war sicher. Aber was für ein Bock, dazu konnte ich noch nichts sagen, er heilt sein Haupt noch immer unten. Wenigstens änderte er jetzt seine Richtung und zog langsam breit. Die Waffe hatte ich bereits im Anschlag, mit dem Zielglas hielt ich auf die Stelle im schon gut kniehohen Gras, an der das Haupt des Bockes war. Die Sicherung war bereits nach vorne geglitten, der Finger lag am Stecherzüngel. Mit zusammengepressten Lippen mäuselte ich den Bock an. Im Aufwerfen sah ich zwei knapp lauscherhohe Gäbelchen. Dann warf es den Bock ins Gras. Ganz selten nur haben mir nach einem Schuss so die Knie gezittert wie damals. Die Zigarette brachte ich kaum aus der Schachtel, und während ich sie rauchte, wurden mir die Beine so weich, dass ich mich ins Gras setzen musste. Als ich mich dann wieder beisammen hatte, stand ich auf, trat ans Wild und begann die rote Arbeit. Den Aufbruch ließ ich mit einem halblauten: „Dank’ Dir, Du hast es Dir wirklich verdient!“ im Gras liegen. Dann schränkte ich den Bock, hing ihn mir über die Achsel und ging durch die Wiese Richtung Middle Barn, wo mein Land Rover stand. Nach vierzig Schritt blieb ich stehen und blickte noch einmal zurück auf die Stelle dieses raren Erlebnisses. Im Durchlass der Hecke saß ein Fuchs mit nur einem Gehör und leckte sich die Lefzen.
Ich bin selten einmal so nachdenklich von einer Jagd heimgekehrt wie an diesem Abend. Und darüber, dass der Jagdherr an diesem Abend bei Freunden zum Diner geladen war und ich mithin allein im Hause war, darüber war ich nicht im mindesten traurig. Ich öffnete mir eine Flasche, die Hausherr Tristan großzügig bereitgestellt und mit weisem Vorausblick bereits auf Trinktemperatur gebracht hatte und ließ diesen unwirklichen, diesen unglaublichen Abend noch einmal vorm inneren Aug werden und vergehen. Ich verbot mir jegliche Sentimentalität in der Beurteilung dessen, was ich da erlebt hatte und dessen Ergebnis nun in der Wildkammer hing. Ein Wildtier hatte mir den Weg zu seiner und meiner Beute gezeigt, hatte sich mit mir eingelassen, hatte – offensichtlich gesund – die Scheu vor dem Erzfeind Mensch abgelegt. Mehr noch, das Tier hatte Vertrauen gefasst, hatte mir sein Wertvollstes, seine Jungen gezeigt und hatte mich (so zumindest fühle ich es) zwar mittelbar, aber dennoch an der Aufzucht der Jungen teilhaben lassen. Die Fuchsfee hatte mit mir – recht besehen – gejagt. War es vermessen zu denken, zu glauben oder zu fühlen, dass ich jetzt an der Stelle stand, an der vor Urzeiten Mensch und Wolf gestanden hatten, an just der Schwelle, wo aus Nahrungskonkurrenten eine Zweckgemeinschaft wurde, die bis heute andauert? Es mochte der Wein sein, der mich in große Gefühle trieb. Aber eines wurde mir an dem Abend sehr klar und sehr bewusst: ich hatte eine Freundin gewonnen, wie sie rarer kaum sein mochte. Und so sah ich die Fee – und so sehe ich sie heute in der Erinnerung: als meine Freundin.
Es dauerte einige Zeit, bis ich meine Freundin wiedersehen sollte. In den damals verbliebenen Tagen suchte ich Fallen Tree nicht mehr auf. Zum Einen waren andere Ecken wichtiger und einfacher zu bejagen, zum Anderen hatte ich eine gewisse Scheu, wieder dorthin zu gehen. Vielleicht hatte ich mir ja auch nur alles eingeredet, vielleicht hatte der Fuchs nicht zur Hecke und dem Bock dahinter hingedeutet sondern nach einem fetten Mäusenest neben sich in der Wiese geschielt und zugesehen, was der Mensch da vorne wollte. Und eines wusste ich ebenfalls sicher: würde ich wieder auf diese Wiese gehen, und wäre ich dort, würde ich den Zauber dieses Erlebnisses wieder haben wollen. Und das schien mir so vermessen, dass ich die Wiese mied.
In der Blattzeit dieses Jahres war ich ein oder zwei Mal dort, sah aber meine Freundin kein einziges Mal. Ich sorgte mich nicht darüber, denn sommers steht das Gras in den Wiesen gut brusthoch. Ein Reh kann man darin kaum sehen, und einen Fuchs erst recht nicht. Zudem hatte ich, als ich dort war, das klare Gefühl, dass es ihr gut gehe. Im Winter kam ich wieder nach Charlton Abbots, allerdings war es mir diesmal nicht um die Rehe, sondern um die Fasanen zu tun. Es war das Jahr, in dem ich mein Hochzeitsgeschenk von Tristan und Georges einlöste und zwei prachtvolle Tage auf hoch und schnell streichende Fasanen jagen durfte. Diese Jagd ist im ersten Buch beschrieben worden, aber es war mir schon ein sehr gutes Omen, dass der erste Trieb des ersten und der letzte Trieb des letzten Tages so gelegt waren, dass das Wild über die Schützen hinweg auf die Wiesen von Fallen Tree und Bees hinausgetrieben wurde. Im ersten dieser beiden Triebe schoss ich nicht sonderlich gut. Im letzten Treiben dieser großen Jagd kamen mir zwar wenige Fasanen, weil ich fast am Ende der Schützenkette stand, aber auf die, die mich anstrichen, kam ich – für meine bescheidenen Verhältnisse – prachtvoll zurecht. Der letzte Vogel dieses Tages ist mir in besonderer Erinnerung: von zehn Fasanen, die über meinen Stand in großer Fahrt und Höhe herstrichen, hatte ich unglaubliche sieben heruntergeholt. Endlich war es – nach vielen schweren und anstrengenden Schüssen in den Trieben zuvor – freies und leichtes Schießen geworden: ich hatte Schwung und Blick, und hob ich die Flinte ins Ziel, dann fiel es auch. Dann aber kam ein Bukett von Fasanen, und ich beging den dümmsten Fehler, den man auf der Schrotjagd begehen kann: ich ließ Gier das Ruder übernehmen. Anstatt ruhig und überlegt wie bisher Vogel für Vogel zu beschießen, wollte ich nun alle auf einmal haben, und bekam so natürlich keinen. Ich stocherte zweimal zwei Schuss irgendwo in die Lücken des Buketts hinein und schalt mich im Absetzen der Flinte einen rechten Trottel. Dann riss der Flug – es ging schon auf das Ende des Triebes hin – ab, und mein Lader Jim meinte, es wäre nun vorbei, ich könnte genauso gut entladen. Da er auf dieser Jagd seit Jahren lädt und zudem ein guter Schießlehrer ist, vertraute ich ihm, entlud meine Flinte, hängte sie in meine Armbeuge, gab ihm aber – wahrscheinlich aus reiner Gedankenlosigkeit – die beiden Patronen nicht zurück, sondern hielt sie in meiner Rechten fest. Im Gespräch ließen wir die beiden Tage Revue passieren, sahen den anderen Schützen bei Glanz oder Elend zu, kommentierten deren Fähigkeiten, genossen die letzten Minuten dieses Jagdtages. Und dann, als der Peloton der Schüsse schon abgeebbt war, als kein Treiber mehr rief, hob sich ganz droben im Hang vor uns ein einzelner Hahn heraus, schraubte sich empor und strich dann in fallender, sausender Fahrt auf mich her. Ich schob die Patronen, die ich immer noch in der Hand hielt, ins Lager meiner Gambetta, schloss das Gewehr, hob es, und der Vogel packte hoch oben Stingel und Schwingen ein und fiel in weiter Parabel herab. In just diesem Moment sah ich vor meinem inneren Auge droben auf den Wiesen einen Fuchs sitzen, der sah dem Fall des Vogel zu, und als der federstiebend aufschlug, war er über der Beute und schleppte das noch warme Federwild davon. Als die Fee in der Hecke abtauchte, war es mir, als hätte sie nur ein Gehör.
Es dauerte bis zum April dieses Jahres dass ich wieder nach Fallen Tree kam. Aber von meiner Freundin war dort nichts zu sehen. Füchse ja, aber alle hatten zwei heile Gehöre. Ich machte mir insgeheim Sorgen. Im Februar hatten wir unseren jährlichen Gaissenriegler gehalten. Wohlweislich hatte ich jeden einzelnen Schützen im dortigen Bereich selbst abgestellt und wieder vom Stande abgeholt, aber weder in den mündlichen noch in den schriftlichen Streckenberichten war von einem erlegten Fuchs die Rede gewesen. Aber konnte ich sicher sein, dass mir alle Schützen auch jede Begebenheit, jeden Schuss, ob Treffer oder Fehler, auch wirklichkeitsgetreu berichtet hatten? Möglicherweise waren aber auch Keeper oder Underkeeper doch einmal auf den Wiesen vorbeigekommen, und die machten mit Charly und seiner Sippe kein Federlesens. Das erste Mal war mir auf der Heimfahrt von Charlton Abbots das Herz schwer.
Auch in der Blattzeit war meine Freundin unauffindbar. Ich mochte dies zwar dem hohen Gras zuschreiben, aber tief in mir drin war aus Sorge Angst geworden. Zwar hatte ich nach der Rehbrunft Zerstreuung genug, denn meine Korrespondenz in London war zu Ende, mit Weib und Hunden zog ich zurück nach Süddeutschland. In all dem Trubel, der Hektik und der Unruhe eines Umzugs über so weite Distanz verging dennoch kein Tag, an dem ich nicht zumindest einmal an die Fee mit dem einen gehör gedacht hätte. Es dauerte lange, bis ich wieder nach Gloucestershire kam: im nächstfolgenden Spätwinter fand kein Gaissenriegler statt, da wir das Geschlechterverhältnis perfekt balanciert hatten und nun versuchsweise den Eingriff alle zwei Jahre vornehmen wollten. Und so war es Mitte Mai, beinahe zwei Jahre nach unserer letzten Begegnung, als ich mein Auto wieder über die heckengesäumten engen Straßen der Cotswolds nach meinem englischen Juwel steuerte.
Fortsetzung in Teil II