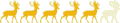- Registriert
- 21 Jul 2006
- Beiträge
- 570
Die Fortsetzung hievon:
viewtopic.php?t=66927
„Enta? Die gibt’s bei uns au!“ Der Rosmer Toni grinste breit. Satz und Grinsen machten mich mächtig neugierig. So sehr ich die Rehböcke im väterlichen Revier schätzte, so sehr war ich durch meinen Weinviertler Lehrjahre auch auf die Niederwildjagd aus. Denn zählt das Reh auch offiziell zur Niederen, war, ist und wird mir sein immer das Pürschen und Hocken drauf Hohe Jagd. Aber die Flinte am Wild zu wetzen, und sei es auch auf ein Kleines nur – da steht mir der Sinn immer danach. Und so hatte ich den Freund und Berufsjager halt einmal danach gefragt, was man denn in unseren Allgäuer Vorbergen mit dem glatten Rohr so anstellen möge. Auf Hasen hatte ich eigentlich gehofft, denn die gab es durchaus auf der Adelegg: dicke, feiste, alte Waldhasen. Und - so dachte ich zumindest damals im jugendlichen Leicht- und Unsinn – der junge Schweisshund vom Toni, die Diana, die würde so ein kleines Hasenjagdel auch goutieren. So bissl brackieren halt. Müsste doch hingehen, oder? Dumm war ich halt damals – oder besser: noch dümmer, als ich es heute bin. Dabei hätte ich mir das so schön ausgedacht: ein kleines Standel oben im Kirchtobel oder Weihertobel, und Diana’s heller Hals im hohen Buchenforst. Und dann auf dem Pass so ein feister Mümmelmann, und der Schuss aus der Sechzehner sauber vornhin, dreieinhalber Schröt, ja, das wär schon was rechtes.
„D’ Diana isch no z'kloi. Und wenn se groß isch, brauch i die für’d Nåchsuche, ond do gohts it, dass se em Has hinterher rennt. Des bring i ihr z’erscht gar it bei!“. Es gibt Argumente, die nicht zu widerlegen sind. Also: die Hasenjagd im Vaterrevier war passé. Aber woran dann die Flinte messen? Tauben: „It gnue då.“ Nusshackel vulgo Eichelhäher: „Hots bloß a de Füttrunge, ond do mag i’s it, wenns rumschießt. D’ Reh brauchet ihr Ruh!“. Fuchsriegeln dann? „Wie witt etzt au Du in dene Tobel drinne en Riegler mache? Des sag’sch mr mol, und dann schwätztet m’r weiter.“ Der Toni war wirklich ein hartnäckiger Kund, aber das mit den Füchsen war jetzt zu durchschaubar: denn Winternacht für Winternacht saß er draußen an den Luderplätzen und holte sich einen Neister Reineke nach dem anderen. Die sauber und selbst gegerbten Bälge, die über dem Stiegengeländer hingen, zeugten deutlich davon. Nur waren sie im Frühjahr dann immer fort – zu Krägen um weiße Weiberhälser gewirkt, dachte ich zuerst. Aber die schiere hohe Zahl der winterlich vom Toni erarbeiten Fuchsbälge ließen logisch nur einen Schluss zu: da ging es dann eher um weiche Fuchsdecken und weiße Weiberleiber drein! „Aber jetzt sag mal: warum hast Du es denn so mit den Füchsen zu tun? Die tun hier im Vorgebirg doch keinen echten Schaden!“ – „Ha woisch – i komm halt vo Ulm her, und do war i früher im a Revier tätig, wo’s viele Enta geba hot. Und do muesch d’r Fux kloi halte.“ Jetzt hatte ich den Toni am Schlaffit! „Enten? Das wär ja auch einmal was Schönes. Aber die gibt’s bei uns ja nicht....“ – „Enta? Die gibt’s bei uns au!“
Droben auf der Höhe freilich gab es diese herrlichen Vögel nicht. Aber unten im Tal, da wo das Revier von den Höhen hinab in die Ebene fiel und über die Bahnlinie Isny-Leutkirch sprang, da gab es einige Tümpel, und im Hinterland dazu lagen größere Seen. Diesen ganzen Revierteil kannte ich so gut wie überhaupt nicht, denn der war den jagenden Angestellten der väterlichen Verwaltung als Regiejagd überlassen. Die Namen der Ecken kannte ich wohl, von Aigeltshofen über das Schnepfenmöösle bis zum Bandten hin. Und just in diesem Bandten lagen einige kleine Weiher. Wobei: die Bezeichnugn „Weiher“ traf wohl nur auf zweie davon zu, die anderen waren kleine Tümpel, kaum grad mehr als bessere Wasserlachen, und völlig krautig dazu. Der größere der beiden Weiher lag einsam auf einer großen Freifläche, drum war dort auf Enten wenig zu wollen. Die strichen weg, kaum das man auf die Fläche kam, und flach dazu. Kein Schießen drauf, das auch nur halbwegs wäre vertretbar gewesen. Der andere aber, der war allseits von hohen Bäumen umgeben, und rund ums Wasser wuchsen Weiden dicht, Holler und Hasel. Da konnte man schön gedeckt dazu, und die Antvögel mussten hoch hinaus, wollten sie fort. Da, meinte der Toni, und nur da hätte es überhaupt einen Sinn. Diese doch recht zurückhaltende Aussage machte mich ein wenig stutzig: Enten gäbe es bei uns, das hatte er mir doch gesagt. Ja, schon, aber!
„Aber“. Das ist so ein Wort, das ich - dreht es sich ums Jagen – so gern nicht hab, speziell, wenn die erste Silbe so lang gezogen wird und die zweite dann mit abfallend leiser Stimme daherkommt. Denn wenn man es recht nimmt, dann kommt dieses „Aber“ beinah immer nur im Einschränkenden, im Chancen und Aussicht mindernden Sinn und Zusammenhang daher. „Der Bock ist kapital, aaaber.... zu gut, zu jung, zu weit droben, zu weit drunten, kaum zu derlangen, dem Gast, dem Forstmeister, dem Jagdherrn vorbehalten.“ Das andere „Aber“, dessen „a“ ganz leis daherkommt, und dessen Schlusssilbe hell nach oben hin gesprochen wird, das hat halt doch viel mehr Tröstliches: „Den Hirsch da, den haben wir vertappt, aber da hinten schreit noch ein anderer, der klingt fast noch eins älter, den schauen wir uns an.“ Leider war nun des Toni’s „Aber“ von der Ersten Art und Ton. Enten gäbe es wohl. Hin und wieder. Sei halt doch nur ein kleines Weiherle da im Bandten, und die großen Urseen und der Badsee und der Gottrazhofer Stausee im Bestfall drei und vier und fünf Kilometer nur entfernt, in Entenmaßen kaum der Rede wert. Und so blieben halt nur ganz manchmal ein oder zwei oder vielleicht auch einmal drei Antvögel auf dem Weiher sitzen. Aber probieren könnte man das Ding dennoch.
Damals – und gottgedankt heute auch noch – war es und ist es mein Denken und Dafürhalten, dass man nichts unversucht lassen soll, gerade und besonders auf der Jagd und ganz speziell beim kleinen Jagern. Der Samstag stand vor der Tür, und für den Abend war der Toni unverplant. Die Abendpürsch würde den Toni und mich hinauf in die Höhen des Reviers führen, auf die Almen und von dort aus in die Tobel hinein. War es auch der August grade einen Tag vorrüber: ein paar alte Knaben würden sich schon noch irgendwo herumdrücken, die der Anschau wert waren und die eine schnelle Kugel mild ihrer irdischen Sorgen entheben mochte. Davor aber wollten wir einen schnellen Abstecher machen in den Bandten hinein und ans Weiherle. Wer weiß, vielleicht stünde ja was auf, jedem langgezogenen „Aber“ zum Trotz.
Meine Sechzehnerin war schon seit dem Vortag wohl vorbereitet, ein ums andere Mal zerlegt und gereinigt und fein geölt. Und zur Munition hatte ich mir einen besonderen und lang gehüteten Schatz auserkoren. Denn da der Vater nur Zwölferflinten schoss, war um Patronen für meine Sechzehnerin immer große Knappheit, zumal ich grad noch ein Schulbub war und mein Säckel dementsprechend anämisch. Aber als ich zwei Jahre davor meine Jagdprüfung abgelegt hatte, als ich sieben von zehn Tontauben zu treffen hatte, da war das Gewehr, mit dem alle Prüflinge zu schießen hatten eine altehrwürdige Ferlacher Flinte des Kalibers 16 gewesen, und ein jeder von uns hatte zwanzig Patronen ausgehändigt bekommen. Sieben davon hatte ich übrig behalten, neun Tauben warn zu Staub geworden. Und war es vielleicht auch nur eine Sentimentalität: diese sieben Patronen hatte ich wie einen Schatz gehütet. Zu einer Rosette geordnet standen sie auf meinem Schreibtisch in Weyerburg, und in den Sommerferien, wenn es heim ins Allgäu ging, da fuhren sie im Westentaschel mit. Ein ums andere Mal hatte ich eine davon in Händen, fühlte ihren schlanke, festen Leib, schüttelte sie sacht und fühlte das Leben der Schrote darin, legte sie mir dann auf die Handfläche und besah sie mir wieder und wieder: den glänzenden messingnen Stoßboden mit Kaliberbezeichnung und Herstellername „Hirtenberger“, das kupferne Zündhütel, das auf den Schlag des Bolzen hin eine Stichflamme in den Pulverraum schießen würde, auf dass die kleinen grünen Plättchen darein schlagartig verbrennen, den braunen Filzpfropfen samt den davorliegenden Schröteln aus der Hülse in den Lauf und daraus ins Ziel treiben würden. Und fiele dieses Ziel dann, würde langsam, einem leisen Schneefall gleich ein weißes Blättchen dazu herabschweben, darauf eine schwarze 6 ½ stand, kennzeichnend die Schrotstärke von zwo komma sechs Millimetern. Karmesinrot waren diese Papphülsen, mit schwarzem Längsstrich gezeichnet, der mittig unterbrochen in sauberen Lettern die Hülsenlänge 67,5 mm zeigte, und auf der anderen Seite stand in geschwungenen Buchstaben der Name der Patrone: „Schnepf“. Ein solcher war mir leider nie gekommen, wenn ich – zweie meiner sieben Schätze in den Lagern – frühjahrs im Wald gestanden war, auf einen puitzenden, quorrenden, gaukelschwebenden oder zwickpfeilenden Murkerich. Das hat sich übrigens bis auf den heutigen Tag, auch wenn ich es oft versucht habe: nie bin ich beim Frühjahrsstrich auf einen Schnepf auch nur einen Schuss losgeworden. Und da die Langschnäbel mich und ihre feurige Namensbase so deutlich meiden, war es nur konsequent, dass ich mit diesen Patronen nun Breitschnäbel wollte vom Himmel holen. Und des Toni alte Vorstehhündin, die treu-behäbige Flora, die würde dann ihre Freude haben, das Wild aus dem Wald, dem Schilf oder dem spätsommerwarmen Weiherwasser zu bergen.
Samstag war es endlich. Früh schon war ich wach und fuhrwerkte in der Küche herum. Der Vater war mit dem Toni zur Morgenpürsch ausgegangen, und kämen beide heim würden sie sich wohl über ein Frühstück freuen. Die Mutter mochte drum ein Stündlein vielleicht länger schlafen, brauchen könnte sie es wohl. Semmeln hatte ich knusperfrisch vom Bäcker geholt, der Tisch war gedeckt, der Porzellanfilter zur Bereitung des Türkentrankes stand bereit, Speck und Eier ebenfalls. Und kämen beide mit einem Bock heim, waren Apfel, Zwiebel, Butter, Mehl und Kümmelkorn zur Hand, der gehäuteten Leber desselben ein geeignetes, duftiges Bett auf dem Herd zu bereiten, grober Senf und Rahm desgleichen, denn auch die Nierlein eines Bockes wollten wohl versehen sein. Und falls es gar ein guter Bock sein sollte, hatte ich aus dem Keller eine ebenbürtige Flasche aus dem Pauillac vorsorglich chambriert.
Als ich mit den Vorbereitungen fertig war, wies die Küchenuhr auf Acht. War wohl noch ein wenig früh, aber mochte schon passen. Ich setzte mich auf die Stufen vor die Küche in die Morgensonne. Rauchkraut war zur Hand, und ein barmherziger Radiosender brachte Beethovens Alters- und Meisterwerk, seine große, seine Neunte Symphonie, dieses genial prachtvolle Ding, darin alles Leid, aller Schmerz, aller Grant des greisen Großen liegt. Das Allegro des Ersten Satzes träumte ich über ein oder zwei Zigaretten in den Sommermorgen hinein, zum Molto Vivace des zweiten Satz braute ich mir auf der Gasflamme des Herdes zur Feier der Stunde und ganz außergewöhnlich – weil eigentlich der Vorbereitung postcranialen Mittagsschlummer vorbehalten, von mir aber zu jeder Stunde geliebt – einen steifen Mocca mit allen Spezereien an Vanille, Zimmet und Kardamom nach der goldenen Regel Dreiklang: schwarz wie die Nacht, heiß wie die Hölle und süß wie die Sünde. Genoss den Zaubertrank zum Adagio des Dritten und tauchte ernstlicher Hoffnung nicht von den Heimkehrenden gestört zu werden in die mächtige Magie des Vierten, des Schlussatzes ein. Die tiefen Streicher trugen mich hinein, die Bläser geleiteten mich, die Paukenführten endlich durch die Spannung hin zum erlösend-ankündigendenen „Oh Freunde, nicht diese Töne“. Und dann war’s ein einziges Schwelgen in der Freude schöner Götterfunken, im großen Wurf, eines Freundes Freund zu sein. Und Gott gepriesen: der war mir reichlich gelungen, und ich musste mich nicht weinend aus diesem Rund stehlen, sondern durfte Freude trinken und mich insgeheim freuen an den Blüten, die sie uns gab und auf den Reben sowiederen Saft, den ich mit Bestimmtheit gleich würde trinken dürfen mit Vater, Mutter und Jager an der Strecke eines guten Bockes, denn nun war die Neun bald da und die Revierpartie noch nicht, somit musste Strecke gemacht worden sein. Wie Sieger würden sie heimkehren, freudig wie’s der Sonnenmarsch beschrieb. Und als der gesungen ward, als der Chor anhub zum „Seid umschlungen, Millionen“, da kam durch die Buchen her endlich der grüne Wagen des Jagers mit dem Vater darein. Gleich würde er aussteigen, der Toni das Türle des Gepäckraumes öffnen, die schwergefüllte Wildwanne herauswuchten, und Flora spränge hinterdrein, etwas steifbeinig zwar, aber wedelnd mit der kupierten Rute und lachend übers ganze graue Gesicht. Der Kies knirschte unter den Reifen, der Jeep hielt an. Der Vater stieg aus und kein grünes Reis zierte seinen Hut. Ernst blickte er drein, und als der Toni ausstieg, war sein Gesicht aschgrau. Er öffnete den Gepäckraum, ich trat dazu. Die Wildwanne war leer, und Flora lag flach hechelnd darin, beinah reglos, die Augen geschlossen. Der Toni sah stumm auf seinen Hund, die dargebotene Zigarette nahm ehr beinah teilnahmslos entgegen und steckte sie sich in den tief herabgezogenen Mundwinkel. Die sonst stets lachenden Augen darüber waren tränenfeucht. Und dann erzählte er langsam die ganze Tragödie dieses Spätsommermorgens.
Von den Alpe Herrenberg herab waren Vater und Jager auf einen einsam in langem Schlag stehenden Hochstand gegangen, die „Kalte Kanzel“ geheißen. Dort hatte mein Vater im ersten Licht ein schwaches Wildkalb beschossen, aber die Kugel war nicht recht geraten und das Kalb offenbar schwerkrank hangab in einen steilen Tobel gezogen. Nach gerechtem Zuwarten hatte Toni Flora zur Fährte gelegt, der Hund hatte sie aufgenommen, das Kalb mit hellem Hals gehetzt, dann sei Standlaut und dann endlich Stille gewesen. Der Toni war dem Bail nachgegangen, nach längerer Zeit zurückgekommen, aber ohne das Kalb und in seinem Armen den apathischen Hund. Die rechte Lefze war unförmig angeschwollen und innen dunkeviolett verfärbt, rings um zwei tiefrote Punkte herum. Der Hund musste, als er das kranke Kalb gestellt hatte, an die Giftschlange unserer Gegend, die Kreuzotter oder an ihre schwarze Base, die Höllenotter, auch Bergviper genannt, geraten sein. Der Wurm hatte den wahrscheinlich annehmenden Hund in die Lefze gebissen und sein Gift hineingejagt. Dem durch die Hatz erhitzen Hund war das Gift nun doppelt schnell in den Leib gefahren. Dem Toni wurden die Augen nass, er legte seine Flora sacht auf ihre Decke. Ich bot ihm an, ihn zum Tierarzt zu begleiten. Er schüttelte seinen Kopf: „Noi, des muess i alloi mache.“ Dann fuhr er davon.
Es war ein trauriger Vormittag. Flora stand im elften Feld und hatte ihr Leben lang hart gearbeitet. Die Chancen standen nicht gut für den Hund. Wir saßen stumm am Frühstückstisch, schmecken wollte es keinem recht. Dem Vater wog alles schwer auf dem Herzen, er gab sich die Schuld an dem Unglück. Hätte er das Kalb recht getroffen, hätte er mit mehr Ruhe geschosssen, bessere Stellung, besseres Licht abgewartet, dann wäre all das nicht passiert: der Hund auf den Tod krank, das Kalb nicht zustand. Den Trost der Mutter wollte er nicht annehmen, verzog sich in sein Arbeitszimmer und wollte dort nicht gestört sein. Ich versorgte sein Gewehr und deckte dann den Tisch ab. Zum ersten Mal hatte ich meinen Freund, den Toni tieftraurig erlebt und wollte mir nicht ausmalen, was mit ihm werden würde, wenn sein Hund an dem Biss der Schlange einginge. Auch die Mutter sprach nur wenig, der Tag floss in bleierner Stille dahin. Gegen Mittag wurde es mir zu unerträglich. Ich griff zum Telefon und wählte Tonis Nummer, ohne Erfolg. Im Abstand von jeweils fünf Minuten versuchte ich es wieder und wieder, und nach zehn oder zwanzig Versuchen endlich knackte es in der Leitung, und der Jager nahm den Hörer ab.
„Toni, was ist mit der Flora?“. Stille in der Leitung, schwer gehender Atem nur war zu hören. Die Kehle wurde mir eng. Endlich kam seine Stimme: „Se schloft jetzt. D’r Dokter hot ihr was g’schpritzt. Er moint, se kennts schaffe.“ Die Mutter kam dazu und nahm drückte auf die Lautsprechertaste des Telefons: „Herr Rosmer, was ist?“ Toni gab ihr die selbe Antwort wie mir. „Wie schaut die Lefze innen aus? Bitte drücken sie einmal ganz vorsichtig von innen gegen die Bissstelle. Wird die weiß und färbt sich dann wieder? Ja? Das ist gut. Wie atmet der Hund? Flach aber ruhig? Auch das ist ein gutes Zeichen. Lassen Sie sie schlafen, und wenn sie wach ist, dann geben sie ihr ein wenig laue Milch zu trinken, und versetzen sie die mit ein wenig leichtem Kaffee. Milch entgiftet, und der Kaffee stütz den Kreislauf. Wir rufen ab jetzt jede Stunde einmal an. Wenn Sie irgend etwas brauchen, bitte melden Sie sich.“ Floras Krise war gegen Drei Uhr nachmittags überwunden. Sie war aufgewacht, hatte Toni mit zwar schwachem, aber deutlichem Schwanzwedeln begrüßt und sogar so etwas wie ein kleines Grinsen zuweg gebracht. Den Milchkaffe hatte sie dankbar gesoffen, und dadurch war sie deutlich kregler geworden. Um Vier Uhr klingelte das Telefon wieder. Ich nahm ab, der Toni war dran: „Pass auf, i komm etzt rei. D’rhoim halt i’s it aus. Mei Freindin isch do und gugget nochem Hund, und mir ganget etzt auf d’Enta. I muess raus, sonscht wer i verruckt.“ Als ich mit Büchse und Flinte in Tonis Auto stieg, fragte ich ihn: „Ist das wirklich eine gute Idee? Dein Hund ist krank, und wir sollen enten jagen gehen?“ – „Woisch was? Wenn i der Flora heut obend a Ente ins Körble leg, was moinsch, wie sich der Hund dann freit? I hon mit d’r Flora soviel auf Enta g’jagt, wenn die oine schmeckt direkt vor d’r Nas, nochet wird se sicher wieder lebig!“
An diesem Nachmittag fielen zwei Erpel im Bandten. Einer hoch im Stich, der andere knickt im Aufsteigen den Stingel an und fiel in den Weiher. Flora lebte noch ein oder zwei Jahre. Bis auf den heutigen Tag sehe ich vor dem inneren Auge, wann immer ein Antvogel in meinem Hagel fällt, ein graues, lachendes Hundegesicht vor mir.
viewtopic.php?t=66927
„Enta? Die gibt’s bei uns au!“ Der Rosmer Toni grinste breit. Satz und Grinsen machten mich mächtig neugierig. So sehr ich die Rehböcke im väterlichen Revier schätzte, so sehr war ich durch meinen Weinviertler Lehrjahre auch auf die Niederwildjagd aus. Denn zählt das Reh auch offiziell zur Niederen, war, ist und wird mir sein immer das Pürschen und Hocken drauf Hohe Jagd. Aber die Flinte am Wild zu wetzen, und sei es auch auf ein Kleines nur – da steht mir der Sinn immer danach. Und so hatte ich den Freund und Berufsjager halt einmal danach gefragt, was man denn in unseren Allgäuer Vorbergen mit dem glatten Rohr so anstellen möge. Auf Hasen hatte ich eigentlich gehofft, denn die gab es durchaus auf der Adelegg: dicke, feiste, alte Waldhasen. Und - so dachte ich zumindest damals im jugendlichen Leicht- und Unsinn – der junge Schweisshund vom Toni, die Diana, die würde so ein kleines Hasenjagdel auch goutieren. So bissl brackieren halt. Müsste doch hingehen, oder? Dumm war ich halt damals – oder besser: noch dümmer, als ich es heute bin. Dabei hätte ich mir das so schön ausgedacht: ein kleines Standel oben im Kirchtobel oder Weihertobel, und Diana’s heller Hals im hohen Buchenforst. Und dann auf dem Pass so ein feister Mümmelmann, und der Schuss aus der Sechzehner sauber vornhin, dreieinhalber Schröt, ja, das wär schon was rechtes.
„D’ Diana isch no z'kloi. Und wenn se groß isch, brauch i die für’d Nåchsuche, ond do gohts it, dass se em Has hinterher rennt. Des bring i ihr z’erscht gar it bei!“. Es gibt Argumente, die nicht zu widerlegen sind. Also: die Hasenjagd im Vaterrevier war passé. Aber woran dann die Flinte messen? Tauben: „It gnue då.“ Nusshackel vulgo Eichelhäher: „Hots bloß a de Füttrunge, ond do mag i’s it, wenns rumschießt. D’ Reh brauchet ihr Ruh!“. Fuchsriegeln dann? „Wie witt etzt au Du in dene Tobel drinne en Riegler mache? Des sag’sch mr mol, und dann schwätztet m’r weiter.“ Der Toni war wirklich ein hartnäckiger Kund, aber das mit den Füchsen war jetzt zu durchschaubar: denn Winternacht für Winternacht saß er draußen an den Luderplätzen und holte sich einen Neister Reineke nach dem anderen. Die sauber und selbst gegerbten Bälge, die über dem Stiegengeländer hingen, zeugten deutlich davon. Nur waren sie im Frühjahr dann immer fort – zu Krägen um weiße Weiberhälser gewirkt, dachte ich zuerst. Aber die schiere hohe Zahl der winterlich vom Toni erarbeiten Fuchsbälge ließen logisch nur einen Schluss zu: da ging es dann eher um weiche Fuchsdecken und weiße Weiberleiber drein! „Aber jetzt sag mal: warum hast Du es denn so mit den Füchsen zu tun? Die tun hier im Vorgebirg doch keinen echten Schaden!“ – „Ha woisch – i komm halt vo Ulm her, und do war i früher im a Revier tätig, wo’s viele Enta geba hot. Und do muesch d’r Fux kloi halte.“ Jetzt hatte ich den Toni am Schlaffit! „Enten? Das wär ja auch einmal was Schönes. Aber die gibt’s bei uns ja nicht....“ – „Enta? Die gibt’s bei uns au!“
Droben auf der Höhe freilich gab es diese herrlichen Vögel nicht. Aber unten im Tal, da wo das Revier von den Höhen hinab in die Ebene fiel und über die Bahnlinie Isny-Leutkirch sprang, da gab es einige Tümpel, und im Hinterland dazu lagen größere Seen. Diesen ganzen Revierteil kannte ich so gut wie überhaupt nicht, denn der war den jagenden Angestellten der väterlichen Verwaltung als Regiejagd überlassen. Die Namen der Ecken kannte ich wohl, von Aigeltshofen über das Schnepfenmöösle bis zum Bandten hin. Und just in diesem Bandten lagen einige kleine Weiher. Wobei: die Bezeichnugn „Weiher“ traf wohl nur auf zweie davon zu, die anderen waren kleine Tümpel, kaum grad mehr als bessere Wasserlachen, und völlig krautig dazu. Der größere der beiden Weiher lag einsam auf einer großen Freifläche, drum war dort auf Enten wenig zu wollen. Die strichen weg, kaum das man auf die Fläche kam, und flach dazu. Kein Schießen drauf, das auch nur halbwegs wäre vertretbar gewesen. Der andere aber, der war allseits von hohen Bäumen umgeben, und rund ums Wasser wuchsen Weiden dicht, Holler und Hasel. Da konnte man schön gedeckt dazu, und die Antvögel mussten hoch hinaus, wollten sie fort. Da, meinte der Toni, und nur da hätte es überhaupt einen Sinn. Diese doch recht zurückhaltende Aussage machte mich ein wenig stutzig: Enten gäbe es bei uns, das hatte er mir doch gesagt. Ja, schon, aber!
„Aber“. Das ist so ein Wort, das ich - dreht es sich ums Jagen – so gern nicht hab, speziell, wenn die erste Silbe so lang gezogen wird und die zweite dann mit abfallend leiser Stimme daherkommt. Denn wenn man es recht nimmt, dann kommt dieses „Aber“ beinah immer nur im Einschränkenden, im Chancen und Aussicht mindernden Sinn und Zusammenhang daher. „Der Bock ist kapital, aaaber.... zu gut, zu jung, zu weit droben, zu weit drunten, kaum zu derlangen, dem Gast, dem Forstmeister, dem Jagdherrn vorbehalten.“ Das andere „Aber“, dessen „a“ ganz leis daherkommt, und dessen Schlusssilbe hell nach oben hin gesprochen wird, das hat halt doch viel mehr Tröstliches: „Den Hirsch da, den haben wir vertappt, aber da hinten schreit noch ein anderer, der klingt fast noch eins älter, den schauen wir uns an.“ Leider war nun des Toni’s „Aber“ von der Ersten Art und Ton. Enten gäbe es wohl. Hin und wieder. Sei halt doch nur ein kleines Weiherle da im Bandten, und die großen Urseen und der Badsee und der Gottrazhofer Stausee im Bestfall drei und vier und fünf Kilometer nur entfernt, in Entenmaßen kaum der Rede wert. Und so blieben halt nur ganz manchmal ein oder zwei oder vielleicht auch einmal drei Antvögel auf dem Weiher sitzen. Aber probieren könnte man das Ding dennoch.
Damals – und gottgedankt heute auch noch – war es und ist es mein Denken und Dafürhalten, dass man nichts unversucht lassen soll, gerade und besonders auf der Jagd und ganz speziell beim kleinen Jagern. Der Samstag stand vor der Tür, und für den Abend war der Toni unverplant. Die Abendpürsch würde den Toni und mich hinauf in die Höhen des Reviers führen, auf die Almen und von dort aus in die Tobel hinein. War es auch der August grade einen Tag vorrüber: ein paar alte Knaben würden sich schon noch irgendwo herumdrücken, die der Anschau wert waren und die eine schnelle Kugel mild ihrer irdischen Sorgen entheben mochte. Davor aber wollten wir einen schnellen Abstecher machen in den Bandten hinein und ans Weiherle. Wer weiß, vielleicht stünde ja was auf, jedem langgezogenen „Aber“ zum Trotz.
Meine Sechzehnerin war schon seit dem Vortag wohl vorbereitet, ein ums andere Mal zerlegt und gereinigt und fein geölt. Und zur Munition hatte ich mir einen besonderen und lang gehüteten Schatz auserkoren. Denn da der Vater nur Zwölferflinten schoss, war um Patronen für meine Sechzehnerin immer große Knappheit, zumal ich grad noch ein Schulbub war und mein Säckel dementsprechend anämisch. Aber als ich zwei Jahre davor meine Jagdprüfung abgelegt hatte, als ich sieben von zehn Tontauben zu treffen hatte, da war das Gewehr, mit dem alle Prüflinge zu schießen hatten eine altehrwürdige Ferlacher Flinte des Kalibers 16 gewesen, und ein jeder von uns hatte zwanzig Patronen ausgehändigt bekommen. Sieben davon hatte ich übrig behalten, neun Tauben warn zu Staub geworden. Und war es vielleicht auch nur eine Sentimentalität: diese sieben Patronen hatte ich wie einen Schatz gehütet. Zu einer Rosette geordnet standen sie auf meinem Schreibtisch in Weyerburg, und in den Sommerferien, wenn es heim ins Allgäu ging, da fuhren sie im Westentaschel mit. Ein ums andere Mal hatte ich eine davon in Händen, fühlte ihren schlanke, festen Leib, schüttelte sie sacht und fühlte das Leben der Schrote darin, legte sie mir dann auf die Handfläche und besah sie mir wieder und wieder: den glänzenden messingnen Stoßboden mit Kaliberbezeichnung und Herstellername „Hirtenberger“, das kupferne Zündhütel, das auf den Schlag des Bolzen hin eine Stichflamme in den Pulverraum schießen würde, auf dass die kleinen grünen Plättchen darein schlagartig verbrennen, den braunen Filzpfropfen samt den davorliegenden Schröteln aus der Hülse in den Lauf und daraus ins Ziel treiben würden. Und fiele dieses Ziel dann, würde langsam, einem leisen Schneefall gleich ein weißes Blättchen dazu herabschweben, darauf eine schwarze 6 ½ stand, kennzeichnend die Schrotstärke von zwo komma sechs Millimetern. Karmesinrot waren diese Papphülsen, mit schwarzem Längsstrich gezeichnet, der mittig unterbrochen in sauberen Lettern die Hülsenlänge 67,5 mm zeigte, und auf der anderen Seite stand in geschwungenen Buchstaben der Name der Patrone: „Schnepf“. Ein solcher war mir leider nie gekommen, wenn ich – zweie meiner sieben Schätze in den Lagern – frühjahrs im Wald gestanden war, auf einen puitzenden, quorrenden, gaukelschwebenden oder zwickpfeilenden Murkerich. Das hat sich übrigens bis auf den heutigen Tag, auch wenn ich es oft versucht habe: nie bin ich beim Frühjahrsstrich auf einen Schnepf auch nur einen Schuss losgeworden. Und da die Langschnäbel mich und ihre feurige Namensbase so deutlich meiden, war es nur konsequent, dass ich mit diesen Patronen nun Breitschnäbel wollte vom Himmel holen. Und des Toni alte Vorstehhündin, die treu-behäbige Flora, die würde dann ihre Freude haben, das Wild aus dem Wald, dem Schilf oder dem spätsommerwarmen Weiherwasser zu bergen.
Samstag war es endlich. Früh schon war ich wach und fuhrwerkte in der Küche herum. Der Vater war mit dem Toni zur Morgenpürsch ausgegangen, und kämen beide heim würden sie sich wohl über ein Frühstück freuen. Die Mutter mochte drum ein Stündlein vielleicht länger schlafen, brauchen könnte sie es wohl. Semmeln hatte ich knusperfrisch vom Bäcker geholt, der Tisch war gedeckt, der Porzellanfilter zur Bereitung des Türkentrankes stand bereit, Speck und Eier ebenfalls. Und kämen beide mit einem Bock heim, waren Apfel, Zwiebel, Butter, Mehl und Kümmelkorn zur Hand, der gehäuteten Leber desselben ein geeignetes, duftiges Bett auf dem Herd zu bereiten, grober Senf und Rahm desgleichen, denn auch die Nierlein eines Bockes wollten wohl versehen sein. Und falls es gar ein guter Bock sein sollte, hatte ich aus dem Keller eine ebenbürtige Flasche aus dem Pauillac vorsorglich chambriert.
Als ich mit den Vorbereitungen fertig war, wies die Küchenuhr auf Acht. War wohl noch ein wenig früh, aber mochte schon passen. Ich setzte mich auf die Stufen vor die Küche in die Morgensonne. Rauchkraut war zur Hand, und ein barmherziger Radiosender brachte Beethovens Alters- und Meisterwerk, seine große, seine Neunte Symphonie, dieses genial prachtvolle Ding, darin alles Leid, aller Schmerz, aller Grant des greisen Großen liegt. Das Allegro des Ersten Satzes träumte ich über ein oder zwei Zigaretten in den Sommermorgen hinein, zum Molto Vivace des zweiten Satz braute ich mir auf der Gasflamme des Herdes zur Feier der Stunde und ganz außergewöhnlich – weil eigentlich der Vorbereitung postcranialen Mittagsschlummer vorbehalten, von mir aber zu jeder Stunde geliebt – einen steifen Mocca mit allen Spezereien an Vanille, Zimmet und Kardamom nach der goldenen Regel Dreiklang: schwarz wie die Nacht, heiß wie die Hölle und süß wie die Sünde. Genoss den Zaubertrank zum Adagio des Dritten und tauchte ernstlicher Hoffnung nicht von den Heimkehrenden gestört zu werden in die mächtige Magie des Vierten, des Schlussatzes ein. Die tiefen Streicher trugen mich hinein, die Bläser geleiteten mich, die Paukenführten endlich durch die Spannung hin zum erlösend-ankündigendenen „Oh Freunde, nicht diese Töne“. Und dann war’s ein einziges Schwelgen in der Freude schöner Götterfunken, im großen Wurf, eines Freundes Freund zu sein. Und Gott gepriesen: der war mir reichlich gelungen, und ich musste mich nicht weinend aus diesem Rund stehlen, sondern durfte Freude trinken und mich insgeheim freuen an den Blüten, die sie uns gab und auf den Reben sowiederen Saft, den ich mit Bestimmtheit gleich würde trinken dürfen mit Vater, Mutter und Jager an der Strecke eines guten Bockes, denn nun war die Neun bald da und die Revierpartie noch nicht, somit musste Strecke gemacht worden sein. Wie Sieger würden sie heimkehren, freudig wie’s der Sonnenmarsch beschrieb. Und als der gesungen ward, als der Chor anhub zum „Seid umschlungen, Millionen“, da kam durch die Buchen her endlich der grüne Wagen des Jagers mit dem Vater darein. Gleich würde er aussteigen, der Toni das Türle des Gepäckraumes öffnen, die schwergefüllte Wildwanne herauswuchten, und Flora spränge hinterdrein, etwas steifbeinig zwar, aber wedelnd mit der kupierten Rute und lachend übers ganze graue Gesicht. Der Kies knirschte unter den Reifen, der Jeep hielt an. Der Vater stieg aus und kein grünes Reis zierte seinen Hut. Ernst blickte er drein, und als der Toni ausstieg, war sein Gesicht aschgrau. Er öffnete den Gepäckraum, ich trat dazu. Die Wildwanne war leer, und Flora lag flach hechelnd darin, beinah reglos, die Augen geschlossen. Der Toni sah stumm auf seinen Hund, die dargebotene Zigarette nahm ehr beinah teilnahmslos entgegen und steckte sie sich in den tief herabgezogenen Mundwinkel. Die sonst stets lachenden Augen darüber waren tränenfeucht. Und dann erzählte er langsam die ganze Tragödie dieses Spätsommermorgens.
Von den Alpe Herrenberg herab waren Vater und Jager auf einen einsam in langem Schlag stehenden Hochstand gegangen, die „Kalte Kanzel“ geheißen. Dort hatte mein Vater im ersten Licht ein schwaches Wildkalb beschossen, aber die Kugel war nicht recht geraten und das Kalb offenbar schwerkrank hangab in einen steilen Tobel gezogen. Nach gerechtem Zuwarten hatte Toni Flora zur Fährte gelegt, der Hund hatte sie aufgenommen, das Kalb mit hellem Hals gehetzt, dann sei Standlaut und dann endlich Stille gewesen. Der Toni war dem Bail nachgegangen, nach längerer Zeit zurückgekommen, aber ohne das Kalb und in seinem Armen den apathischen Hund. Die rechte Lefze war unförmig angeschwollen und innen dunkeviolett verfärbt, rings um zwei tiefrote Punkte herum. Der Hund musste, als er das kranke Kalb gestellt hatte, an die Giftschlange unserer Gegend, die Kreuzotter oder an ihre schwarze Base, die Höllenotter, auch Bergviper genannt, geraten sein. Der Wurm hatte den wahrscheinlich annehmenden Hund in die Lefze gebissen und sein Gift hineingejagt. Dem durch die Hatz erhitzen Hund war das Gift nun doppelt schnell in den Leib gefahren. Dem Toni wurden die Augen nass, er legte seine Flora sacht auf ihre Decke. Ich bot ihm an, ihn zum Tierarzt zu begleiten. Er schüttelte seinen Kopf: „Noi, des muess i alloi mache.“ Dann fuhr er davon.
Es war ein trauriger Vormittag. Flora stand im elften Feld und hatte ihr Leben lang hart gearbeitet. Die Chancen standen nicht gut für den Hund. Wir saßen stumm am Frühstückstisch, schmecken wollte es keinem recht. Dem Vater wog alles schwer auf dem Herzen, er gab sich die Schuld an dem Unglück. Hätte er das Kalb recht getroffen, hätte er mit mehr Ruhe geschosssen, bessere Stellung, besseres Licht abgewartet, dann wäre all das nicht passiert: der Hund auf den Tod krank, das Kalb nicht zustand. Den Trost der Mutter wollte er nicht annehmen, verzog sich in sein Arbeitszimmer und wollte dort nicht gestört sein. Ich versorgte sein Gewehr und deckte dann den Tisch ab. Zum ersten Mal hatte ich meinen Freund, den Toni tieftraurig erlebt und wollte mir nicht ausmalen, was mit ihm werden würde, wenn sein Hund an dem Biss der Schlange einginge. Auch die Mutter sprach nur wenig, der Tag floss in bleierner Stille dahin. Gegen Mittag wurde es mir zu unerträglich. Ich griff zum Telefon und wählte Tonis Nummer, ohne Erfolg. Im Abstand von jeweils fünf Minuten versuchte ich es wieder und wieder, und nach zehn oder zwanzig Versuchen endlich knackte es in der Leitung, und der Jager nahm den Hörer ab.
„Toni, was ist mit der Flora?“. Stille in der Leitung, schwer gehender Atem nur war zu hören. Die Kehle wurde mir eng. Endlich kam seine Stimme: „Se schloft jetzt. D’r Dokter hot ihr was g’schpritzt. Er moint, se kennts schaffe.“ Die Mutter kam dazu und nahm drückte auf die Lautsprechertaste des Telefons: „Herr Rosmer, was ist?“ Toni gab ihr die selbe Antwort wie mir. „Wie schaut die Lefze innen aus? Bitte drücken sie einmal ganz vorsichtig von innen gegen die Bissstelle. Wird die weiß und färbt sich dann wieder? Ja? Das ist gut. Wie atmet der Hund? Flach aber ruhig? Auch das ist ein gutes Zeichen. Lassen Sie sie schlafen, und wenn sie wach ist, dann geben sie ihr ein wenig laue Milch zu trinken, und versetzen sie die mit ein wenig leichtem Kaffee. Milch entgiftet, und der Kaffee stütz den Kreislauf. Wir rufen ab jetzt jede Stunde einmal an. Wenn Sie irgend etwas brauchen, bitte melden Sie sich.“ Floras Krise war gegen Drei Uhr nachmittags überwunden. Sie war aufgewacht, hatte Toni mit zwar schwachem, aber deutlichem Schwanzwedeln begrüßt und sogar so etwas wie ein kleines Grinsen zuweg gebracht. Den Milchkaffe hatte sie dankbar gesoffen, und dadurch war sie deutlich kregler geworden. Um Vier Uhr klingelte das Telefon wieder. Ich nahm ab, der Toni war dran: „Pass auf, i komm etzt rei. D’rhoim halt i’s it aus. Mei Freindin isch do und gugget nochem Hund, und mir ganget etzt auf d’Enta. I muess raus, sonscht wer i verruckt.“ Als ich mit Büchse und Flinte in Tonis Auto stieg, fragte ich ihn: „Ist das wirklich eine gute Idee? Dein Hund ist krank, und wir sollen enten jagen gehen?“ – „Woisch was? Wenn i der Flora heut obend a Ente ins Körble leg, was moinsch, wie sich der Hund dann freit? I hon mit d’r Flora soviel auf Enta g’jagt, wenn die oine schmeckt direkt vor d’r Nas, nochet wird se sicher wieder lebig!“
An diesem Nachmittag fielen zwei Erpel im Bandten. Einer hoch im Stich, der andere knickt im Aufsteigen den Stingel an und fiel in den Weiher. Flora lebte noch ein oder zwei Jahre. Bis auf den heutigen Tag sehe ich vor dem inneren Auge, wann immer ein Antvogel in meinem Hagel fällt, ein graues, lachendes Hundegesicht vor mir.