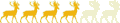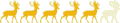- Registriert
- 21 Jul 2006
- Beiträge
- 570
Es wurde darum gebeten. Nehmen wir also eine her, die in die Jahreszeit passt.
Weite Hennen, Hohe Gockel
Der raue Schuss aus dem glatten Lauf war mir lange ein siebenfach versiegeltes Buch. Noch heute sind der sieben Siegel nicht alle gelöst und erbrochen, und manchmal deucht es mir, als verschlössen sie sich eines um das andere wieder, um sich dann ungeahnten Momentes überraschend wieder aufzutun. Anfangs stand ich völlig ratlos vor der Flinte. Mit dem gezogenen Lauf, da war das Treffen keine ganz so schwere Angelegenheit: man musste nur Muck und Grinsel genau zusammenschauen, oder – wenn ausnahmsweise auf der Übungswaffe vorhanden – durchs Zielglas sehen, dann die Waffe ruhig halten oder besser noch: auflegen, das war dann schon fast alles. Das Ziel stand ja still. Wie anders dagegen war das Schießen mit der Flinte: da gab’s kein Grinsel für die Muck, nur eine mehr oder minder definierte, und bei den väterlichen Querflinten überhaupt keine Schiene, in deren ungefährer Mitte ein dickes Korn zu platzieren war. Wie sollte man damit einen nur einigermaßen gezielten Schuss abgeben, noch dazu auf ein Ziel, dass nicht nur nicht stillhält, sondern sich mit großer Geschwindigkeit bewegt?
„Vorhalten musst Du“ – „Blödsinn, nicht vorhalten, vorschwingen!“ – „Habt ja allmitsammen keine Ahnung: von hinten ran ans Ziel und im Überholen schießen, so wird das gemacht!“ Die Ratschläge kamen zu aberhunderten, jeder war richtig und keiner half: wann immer mein Vater mir eine seiner feinen spanischen Querflinten am Tontaubenstand in die Hand drückte, gab es bestenfalls eine satte Watschen, und die Taube ging erst dann zu Bruch, wenn sie weit hinter mir unsanft aus den Boden schlug. Der Stand befand sich – goldene Zeiten, da das noch erlaubt war – im Revier eines Onkels, meines Vaters Schwippschwager: in einer steilen Leiten war da auf einen hohen Turm eine Trapmaschine, ein Taumler montiert worden, die die Ziele bald links, bald rechts, bald hoch bad tief warf. Von Zielansprache, vom Lesen der Bahn, vom englischen „how to adress the bird“: keine Red! Schießen sollte ich, nicht dumm fragen, dann würde es schon tun und taugen – irgendwann halt einmal. Und wenn dann gar mein Cousin, ein schneller und sicherer Flintenschütze, antrat, wenn dann eine Taube nach der anderen am Himmel zerplatzte und er wie zum Hohn den zweiten Schuss einem davonschwirrenden Splitter nachsandte, auf dass dieser auch noch zerstäube, wenn ich ihn dann scheu und schüchtern fragte, wie er diese Zauberkunst, diese Magie wirke, dann gab’s als Antwort meist nur: „Du, das kann ich Dir auch nicht genau sagen!“
Was Wunder, dass mich die Flinte lange Zeit nicht reizte. Was heißt: sie schreckte mich graderwegs ab, dieses tretende, schlagende, laute unberechenbare und nicht zu steuernde Schießding. So ging die späte Kindheit dahin und die frühe Jugend: wenn bei irgendwelchen Sejours der jeunesse dorée die ganz verwegenen unter uns, die, die Schlag bei den Mädeln hatten, wenn die die Flinten nahmen um zu brillieren und zu glänzen, da stand ich abseitig und tat als langweilte mich dies Geballere zu Tode, beschäftigte mich mit den Hunden, oder den Büchern oder mit sonst was, damit nur keiner mich fragte: „Bertram, komm, schieß auch einmal! Wie, warum magst Du nicht? Hast Du Angst gar?“
Ich habe an anderer Stelle beschrieben, wie ich im tiefen Niederösterreich meine ersten Schüsse auf Flugwild getan hatte. Und so sehr mir diese für mich gänzlich neue Art zu jagen auch faszinierte: ich war fern der Heimat im Internat, und in den Sommer- oder anderen Ferien gab’s allenfalls das Luftgewehr, und ansonsten Nachhilfe in Mathematik, Englisch und Latein: die Versetzung war wieder einmal gefährdet. Aber auch das war irgendwann vorbei: die Versetzung war nicht mehr gefährdet, sie war unwiderruflich futsch, und das zum zweiten Mal in Folge. Consilium abeundi, Rauswurf, unehrenhafte Entlassung, Versagen! Es war das beste, was mir damals passieren konnte. Als Nichtsnutz, Dummkopf, Faulpelz und Rohrkrepierer war ich zwar gebrandmarkt, aber viel wichtiger: ich konnte dem bis heute innig verhassten Internat und seinen zum Teil unsäglich verlogenen, machtlüsternen und ihre Position missbrauchenden Patres den Rücken kehren, an der Klosterpforte den Staub von meinen Schuhen schütteln und heilige Eide schwören, dass ich nie wieder hierher zurückkehren würde.
Glücklicher Zufall, eher noch gutgöttliche Fügung ersparten mir die Wahrmachung der elterlichen Drohungen von Maturaschule, Militärakademie oder anderen Zuchthäusern: eine entfernte Tante nahm mich unter ihre breiten Fittiche, und so kam ich in eines der jagdlich versiertesten – oder jagdnarrischsten (wobei das nur die ganz Bösen behaupten) – Häuser Österreichs, kam ich ins Weinviertel. In diesem Zauberschloss meiner Jugend gab es genau drei Beschäftigungen für die Zeit, die nicht der Arbeit, oder im Falle der fünf Hauskinder und meiner Wenigkeit, dem Schulstudium gewidmet war: Reiten, Tennis, Jagd. Wobei das Tennis Winters durch Bridge ersetzt wurde. Aber der Reihe nach: Pferde sind wunderbare, schöne, spannende aber letztlich halt doch völlig wilde Tiere. Zum Tennis eignete und eigne ich mich so wie der Esel zum Brezelbacken. Im Kartenspiel bin ich noch schlechter. Es blieb mir nur die Jagd übrig!
Mit der sollte ich keine vierundzwanzig Stunden nach meiner Ankunft bereits konfrontiert werden: es war ein Samstag, und wir Buben – i.e. die beiden ältesten Söhne des Hauses und zwei Söhne eines nahen Nachbarn sowie ich – mussten beschäftigt werden. Und die Beschäftigung war die: ab in die das Haus umgebende Apfelplantage und die Ringeltauben schießen, die mit den von meinem gleichaltrigen Cousin und Klassenkameraden zum pittoresken Zweck der Turmumkreisung gezüchteten weißen Tauben hässliche Hybriden hervorbrachten.
Binnen kürzestem stand die Korona bewaffnet da: der älteste mit einer .410-Repetierflinte, genannt „Pöff“, der zweite mit einem alten Suhler Drilling im Kaliber sechzehn, die Söhne des Nachbarn mit alten Doppelflinten Brünner Bauart. Und mir drückte der Jagdherr – ich war damals noch unbewaffnet – eine schwere Bockdoppelflinte in die Hand, auf deren Laufbündel einerseits stand: Fabrique National, Herstal, Belgique. Auf der anderen Seite stand: Browning B25.
Das war ein ander Gewehr als die kleinen, leichten, kapriziösen spanischen Senoritas meines Vaters! Die hatten nicht mit mir geredet, die hatten mir gedroht, dass sie, würde ich mit meinen plumpen Dummjungenhänden sie nicht richtig anpacken, mir das Gesicht rot und blau prügeln würden, mich auslachen würden ob meiner Tollpatschigkeit – und jedes Mal hatten sie das Versprechen wahr gemacht, hatten mich wissen lassen, dass sie Rassegeschöpfe seien, von Männerhand nur zum Schönsten zu führen, nicht von dummer Buben Pratzen. Wie anders aber diese ehrwürdige Matrone aus Lüttich. Sie wog beruhigend schwer in meinen Händen, sie versprach mir, dass nicht ich sie, nein, dass sie mich schon recht führen würde. Keine Drohung gab es, nur das Angebot: ‚Lass’ es uns versuchen miteinander. Und wenn Du mich machen lässt, dann wird’s schon werden!’
Die beiden Söhne meines Jagdherrn wussten genau, wo die Flugrouten der Tauben verliefen, und wie sie je nach Wind und Wetter angenommen wurden. An der Südwestseite des Hauses nahmen wir Posten, unser fünf Flinten im Abstand von je gut dreißig Schritt deckten die breite Front gut ab. Es war kein langes Warten, bis die erste Taube hoch über dem Dach erschien. Und hoch über dem Dach hieß: weit weg von uns. Ich habe es mir aus dem Gedächtnis und nach Photos einmal aussummiert: Das Haus, eine alte Burg, steht auf einem Hügel, der an unserer Flanke einen Niveau-Unterschied von guten fünfzehn Metern ausmachte. Das Haus selbst war an dieser Stelle weitere zehn Meter hoch, somit war dieser Vogel von uns aus sichere dreißig wenn nicht mehr Meter über Grund. Und er flog pfeilgerade auf meinen Stand zu. Von links und rechts schallte mir mehrstimmig das „Tire haut!“ in die Ohren. Ohne lang zu überlegen hob ich die schwere Browning-Flinte. Und dann geschah etwas, was ich heute noch in meinen Händen spüren kann: das Gewehr bewegte sich, als hätte es eigen Sinn und Leben, schwang von hinten auf das Ziel, darüber hinaus noch und wollte und wollte nicht aufhören zu schwingen. Irgendwann – und für mein damaliges Denken viel, viel zu spät – zog ich am Züngel, in der festen Überzeugung himmelweit vor der Taube vorbeigeschossen zu haben.
Und als ich die Waffe absetzte, fiel der Vogel steintot vom Himmel herab und landete weit hinter mir im Gebüsch. Das lobende „Bravo“ der anderen hörte ich gar nicht recht, ich war immer noch zu sehr mit dem eben Erlebten beschäftigt: die Flinte hatte das Angebot, dass sie mir stumm und nur durch ihr schwer-behäbiges Wesen unterbreitet hatte, tatsächlich wahrgemacht: ‚Wenn Du mich machen lässt, dann wird’s wohl geraten.’ Und geraten war es, wie durch Zauberhand.
Konnte das denn sein, das ein Gewehr ganz allein, mehr oder minder ungeführt solche Schüsse tat? Heute weiß ich, dass es nicht die Waffe allein war, sondern ein geglücktes Zusammenspiel meiner Unerfahrenheit und einer gut schwingenden, perfekt balancierten Flinte. Ich hatte damals noch nicht den verzweifelt-verkrampften Wunsch, unbedingt treffen zu wollen, der alles, aber auch alles am Flintenschießen zunichte macht. Ich wollte einfach nur keine Watschen von dem Schießprügel bekommen, und drum hatte ich so spät erst den Abzug betätigt, spät genug, um weit genug vor der hohen und schnellfliegenden Taube zu sein. Dahin hatten mich aber das Gewicht und die gute Balance dieser Waffe gebracht.
Ein perfekter Flintenjäger ist aber aus mir in diesem ersten Schuss beileibe nicht geworden, das zeigte sich schon wenige Minuten später: eine andere Taube hatte sich in einen hohen Baum etwa 25 Meter schräg rechts vor mir gestellt, und mein Schützennachbar, der direkt vor dem Baum stand, hieß mich einen Hebschuss tun, damit der Vogel hoch würde und er ihn schießen könne. Das war nun eine Aufgabe, der ich mich dank intensiver (aber meist erfolgloser) Luftgewehrjagd durchaus gewachsen fühlte. Und aus dieser erwähnten Erfahrung heraus wusste ich: eine Taube steht vom bloßen „Patsch“ eines Luftgewehres nicht auf, sie muss das Diabolo-Kügerl schon durch die Blätter prasseln hören, um sich auf die Schwingen zu machen. Ich zielte also – genau wie mit meinem Luftbüchsle – etwas unterhalb des Vogels, drückte ab, und auch diese Taube fiel mitten in der Schrotgarbe steintot zu Boden. Diesmal gab es kein „Bravo“, sondern nur ein sehr trockenes: „Danke sehr, das Totschießen hättest Du mir jetzt nicht abnehmen müssen!“ von meinem Standnachbarn.
Die „EffEnn“, wie diese Flinte hausintern genannt hatte, wo jedes Gewehr seinen Namen hatte, diese FN also wurde während meiner Zeit dort so etwas wie mein Dienstgewehr. Eine eigene Waffe hatte ich nicht, und somit war diese Flinte meine Begleiterin auf den Reviergängen, zu allererst aber Übungsgewehr: der Jagdschein stand an erworben zu werden. In der nahen Bezirkshauptstadt gab es einen Schießstand mit Trap, Skeet und Jagdparcours, und was ich an Taschengeld hatte, beziehungsweise was ich Sommers im väterlichen Forst bei Seilbahn, Klupprotte und Pflanzerei dazuverdient hatte, das trug ich dorthin und investierte es in Schrotpatronen und Tontauben. Und damit begann die eigentliche Misere.
Anstatt so zu treffen, wie ich es beim ersten Schuss mit der FN getan hatte – nämlich frei von Hirnmarterei und Denken – wollte ich ab dato unbedingt treffen. Das gelang halt nur selten. Und wie es schon so ist: auf jedem Schießstand gibt es ein paar Bezirksweltmeister, die sich für die geborenen Schießlehrer halten und mit ihren Ratschlägen, die für den Anfänger bei weitem nicht so gut sind, wie sie gemeint waren, freigiebigst mich bedachten. „Vorne vorbei, hinten vorbei, drüber, drunter. Drauf musst Du schießen. Und weiter vor!“
Was nun? Drauf und Vor sind zwei topographisch klar voneinander getrennte Punkte, und dass ich an der Taube vorbeigeschossen hatte, das konnte ich Mal für Mal genauestens sehen. Sie blieb ja heil. Wenn aber einmal glücklich eine Taube zersprang, dann hieß es: „Jetzt hast Du alles richtig gemacht!“ Und damit wurde man dann stehen ge-, sowie seiner Verzweiflung überlassen. Erst viele Jahre später, zuerst in Buke bei Heinz Oppermann und dann in Großbritannien bei Michael Pinker lernte ich, was richtiger Schießunterricht bedeutet: einen Menschen an der Seite haben, der die Garbe im Flug sehen kann, und den Schützen nicht mit der wenig weiterführenden Information über den klar ersichtlichen Fehlschuss langweilt, sondern ihm die Haltung, den Anschlag, den Schwung korrigiert, ihm den richtigen Gebrauch und die rechte Position der Führhand am Vorderschaft weist, ihm die absolute Wichtigkeit der richtigen Fußstellung und der Beinarbeit beibringt.
Vieles kann man übers Flintenschießen in Büchern lesen. Fürstenberg, Meran, McDonald-Hastings, Nickerson, Oppermann haben alle hervorragendes dazu geschrieben. Am meisten habe ich allerdings aus dem Buch des Flintenschmieds Robert Churchill gelernt: „Game Shooting: The Definitive Book on the Churchill Method of Instinctive Wingshooting for Game and Sporting Clays“, zu Deutsch schlicht: „Das Flintenschießen“. Was dieser große Praktiker und Könner an Wissen in dieses Buch gelegt hat, ist ein Schatz, den zu bergen einem jeden Flintenschützen dringendst angeraten sei. Speziell seine fast unfehlbare Methode eines immer exakt wiederholgenau zu reproduzierenden Anschlags ist ebenso genial wie einfach: er schreibt vor, den Schaft der Flinte in Erwartung des Schusses nicht an der Seite oder gar am Hüftknochen zu halten, wie es der deutsche Funktionärsanschlag verlangt, sondern ihn fest unter die Achsel zu klemmen, zwischen Oberarm und Rippen zu fixieren und dann, wenn die Flinte ins Gesicht soll, sie mit beiden Händen nach vorne zu schieben und zu heben. Wem das nun etwas seltsam vorkommt, der möge es probieren und dabei im Spiegel genau seine Schulter beobachten. Durch diese Bewegung geht der Schaft nämlich nicht an die Schulter, es ist genau umgekehrt: die Schulter geht an den Schaft! Dieser Anschlag ist so wiederholgenau wie eine gute Zielfernrohrmontage, und hat nebstbei den großen Vorteil, dass er eine blaugeschossene Schulter ausschließt. Denn dadurch, dass nicht die Flinte nach hinten an die Schulter, sondern die Schulter nach vorne an den Schaft geht, ist dem Rückstoß ein optimales, schockabsorbierendes Widerlager geboten.
Doch so klug und weise alles ist was in den genannten Büchern geschrieben steht: zur Umsetzung in die Praxis bedarf es entweder großen Talentes oder aber eines Lehrers. Beides hatte ich nicht. Besuche auf dem Schießstand waren also immer von geteiltem Erfolg, je nach Tagesform mal mehr, meist weniger reich an Treffern. Die Jagd auf Flugwild dagegen war über viele Jahre völliges Debakel. Zum unbedingten und verkrampften Treffen-Wollen kam noch die Aufregung, kam das Jagdfieber dazu. Die Einladungen, die Gelegenheiten auf Flugwild zu jagen waren wenige, damit konnte ich mir die für diese Jagd so dringend notwendige Routine nicht zulegen. Meine Schießkünste blieben gering, und damit war’s ein fertiger circulus vitiosus: Wer schlecht schießt, wird selten eingeladen. Wer selten eingeladen wird, hat wenig Übung auf Wild. Wer wenig Übung auf Wild hat, schießt schlecht. Nur manchmal gelang es, einen einzelnen weiten und hohen Vogel, Taube, Ente, Fasan, so tödlich zu treffen, wie es den großen Könnern mit Regelmäßigkeit gelang.
Soviel Theorie ich auch paukte, ich wurde dadurch lediglich theoretisch ein guter Schütze. Und sah neidvoll den anderen, den tatsächlich guten Schützen zu, wie sie einen mir gänzlich unerreichbaren Vogel nach dem anderen mit sauber tötenden Schüssen herunterholten. Ich stand dann da, mit meiner vom Vaterbruder ererbten, langen, schlanken und wunderhübschen 16er Spanierin - und hoffte inständig um KEINEN Anflug, damit ich mich ja nicht blamieren würde.
Ganz selten aber gab es Tage, die unter einer Konjunktion bester Sterne standen. Tage, an denen es völlig wurscht war, ob man abends zuvor zeitig und nüchtern zu Bett gegangen war oder im Suri bis zum Morgengrauen gedraht hatte. Tage, deren Morgenluft nicht wie Champagner prickelte, sondern wie einer der ganz großen, ganz guten österreichischen Weißweine – Grüner Veltliner meinethalb oder Welschriesling – moussierend, frisch, jung, frech, mit einem Wort: resch war. Und stand ich solchen Tags am Stand, da verlangte ich nicht nach dem ersten Vogel, da brannte ich darauf. Kam er dann, ging die Flinte von allein ihren Weg in Schulter und Gesicht, folgte von selbst im Hochnehmen schon der Bahn des Ziels, schwang von sich aus in den richtigen Bereich. Ich musste nur noch abdrücken, und das Wild fiel prachtschillernd und im weiten Bogen zur Erde.
Aus der frühen Zeit, als ich noch meine 16er führte, da ist mir ein solcher Tag besonders erinnerlich. Aber dafür muss ein wenig ausgeholt sein. Als Schüler, Hauskind und Gast im Zauberschloss im Weinviertel war – neben der einen oder anderen Stampereinladung – der niederwilde Höhepunkt das Bauernjagdl: da wurden die Felder, Gräben und Hecken des „Hean Grof“ und die der Jagdgenossenschaft in einer großen, ungemein lustigen und buntstreckigen Jagd genommen. Und weil diese Jagderln einen so besonderen Reiz hatten, lieber Leser, schenk mir ein wenig Geduld und lass mich eine davon beschreiben, bevor ich zu diesem besonderen, reschen Tag komme.
Ich war damals schon aus dem Zauberschloss in (Vorsicht: strapazierter Ausdruck!) meine erste mit Bett, Küche, Sofa, Tisch und gelegentlich auch Damenbesuch möblierte Mansarde gezogen, und saß dort - bestimmt nicht über Lateinstudien, sondern über irgendeinem Gagern oder Meran, mag auch das „Niederösterreichische Weidwerk“ aktueller Ausgabe gewesen sein, Pfeiferl im Maul, Glas mit vom Vater aus dem gewissen Fass stibitzen Whisky darnebst und Schubert, Schumann oder eher noch Mendelssohn im Ohr – als das Telefon klingelte. Der Ziehonkel hieß mich, des soundsovielten currentis, id est Novembris, zu der erwähnten Bauernjagd zu kommen. Das „Selbstverständlich, und gern!“ war Pflicht, Freud und Ehr gleichermaßen. War’s auch kein großes Niederwildschlachten, und hatte man einen Hahn zur Strecke, dann lag man schon über dem Durchschnitt: allein der Figuren wegen, die dem Wesen und den Gesichtern nach grad so gut hätten dem Petermann'schen Jagdbuch entsprungen sein mögen, allein das war es hoch derwert. Und zudem jagte man auf echtes Wild: Fasanen, die schon manches Schrot hatten prasseln hören, die gewitzt waren und sich gockend prasselnden Schwingenschlags senkrecht in die Höh’ schraubten, um dann still und schnell am winterblitzblauen Firmament über die schneebedeckten Schollenäcker der Kellergasse oder dem Katzengraben, der Sandgube oder gar dem Dorf zuzustreichen, salutiert von einem Reihenpeloton, wie er in Präzision und Taktung auch nach schärfstem Üben von der Royal Horse Artillery zum Geburtstag der Queen im Green Park zu London nicht besser geschossen wird. Und so wie Ihre Majestät dazu verbindlich lächelt, so lachte sicher auch der jeweilige Gockel, wenn er sicher und weit hinter der Schützenkette mit den leinenzerrenden Hunden den gefrorenen Löß unter seine Ständer nahm.
„Neun Uhr Treffpunkt im Meierhof!“, hatte es geheißen, und selbstverständlich war man eine halbe Stunde früher da, ebenso selbstverständlich begann die Ansprache des Jagdleiters frühestens eine halbe Stunde nach dem Treffpunkttermin: Ratschen, Rauchen Lachen. Gewehre vergleichen, angeben mit dem neuen Zauberzeug, erst recht dafür aufgezwickt werden. Scheu schauen, ob all die alten Gesichter von „feant“, vom letzten Jahr auch da sind. Still trauern um einen oder zwei, deren Grab auf dem Friedhof die letzen Brüche decken.
„Sad’s endlich ålle då? A Ruah!“ Kurze Fanfare aus einer zerbeulten Kavallerietrompete. „Fasauna schoiß ma heit, Håhna netto, wisst’s as eh. Hås, Künigl, Raubzeigs. Oisdaunn, Weidmanns Heul!“ – „Momenterl!“, meldet die Kavallerietrompete, i.e. der Herr Graf: „Heuer geben wir auch Schweinderln frei bis fuchzig Kilo. Sind ein oder zwei Triebe, wo welche drin sein können.“ Hektisches Abklopfen sämtlicher Jackentaschen: Brenneke dabei? „I hob kane, Du?“ – „I ah ned. Fråg in Bäck, `leicht hod der wås dabei!“ Der Bäck, Wirt im Nachbardorf, grinst. Er hat.
Erster Trieb: Schottergrube. Sommers zwei Jahre davor hatte ich – quasi in der post Jagdprüfung angesetzten praktischen Ausbildung im Fach „Reviereinrichtung“ mittels in einem anderen Revierteil geschnittener, per Moped herangefahrener und dann mühselig in die abrutschgefährdeten Sandwände getriebener Salweiden Erosionsschutz und Deckungsbau betrieben. Die Weidenhecke war gut hochgekommen, vielleicht zahlte sie sich heuer aus. Treiber rein! Von meinem Stand aus sehe ich die Karnickel unbeschossen in Sicherheit flitzen. Wild ist also drinnen. Zwei Hasen flüchten auf den Acker hinaus. Einen rouliert der Nachbar, der andere schlägt auf meinen Schuss das Radl. Dann lange nichts. Ganz zum Schluss steht ein richtiges Bukett Fasanen auf, steil und sehr hoch. So hoch, dass keiner die Flinte hebt. Plötzlich ein rascher Doppelschuss, und zwei Hahnen fallen, klein zusammengepackt in den schneeigen Acker. Großes Raunen und Fragen: „Wer war das?“ Draußen, ganz am Rand der Schottergrube klappt der alte Gock Bauernfeind sein Gewehr auf, nimmt zwei leergeschossene Papphülsen heraus und grinst unter seiner großen Hakennase.
Und so und anders geht es Feld um Waldl fort und fort, hier zwei Hahnen, dort ein Has. Zu Mittag dann heiße Würstl Frankfurter und Debrecziner Machart, Glühmost dazu, „Alsdann, påck ma’s wieda aun!“. Ein halbes Dutzend Hasen liegt am Abend zur Strecke, zwei Dutzend Hahnen. Ja, eine Henn’ auch. Und um halber sechse ist der Schüsseltrieb beim Bäck! Gern wär’ ich noch einmal dabei.
Dann gab es aber Jahr um Jahr noch einen anderen, für uns Jungen nur passiven, dafür aber nicht minder herbeigesehnten Höhepunkt im Jagdjahr: die große, die Schlossjagd. Das Schloss aber, um das sie spielte, das war nicht das erwähnte und beschriebene Zauberschloss, das war der stolze und familiennamengebende Stammsitz des Hauses, erbaut im hohen Barock für den damaligen Fürsterzbischof und Vizekanzler des Heiligen Römischen Reiches. Ein Versailles für sich, hingebettet in einen weitläufigen Park voll hoher Eichen, gelegen zwischen zwei Hügeln, deren jeder obern auf der Krone eine dichtgepflanzte und alterslang gepflegte Remise trug.
Die Namen dieser Remisen hatten hohen und verheißungsvollen Klang unter den großen Flintenschützen früherer Jahre: Auremise und Sandremise hießen die Triebe, Szápáry, Bulagrini, Széchenyi, Traun, Saurma die Schützen . Und wann immer ich als junger Kerl einen der alten Herren traf, die zu dieser Generation gehörten: unweigerlich lösten diese beiden Ortsnamen verklärt-verzückte Minen aus. Entweder hatten sie selbst dort geschossen, oder diese beiden Treibe waren ihnen lebenslang unerreicht und damit umso köstlicher geblieben. Selbst mein Großvater, der bis ins hohe Alter schnell und tödlich sicher seine Flinten führte, kannte diese Triebe gut und schätzte die Tage hoch, an denen er sie geschossen. Sechzig Meter über dem Niveau des Schlossparks liegt die erstgenannte, zwar nur dreißig Meter, aber weit davon weg die zweite der beiden Remisen. Und die Vögel, die daraus getrieben werden, stürzen sich von der höheren pfeilschnell und tauchend, von der zwar niedriger, aber weiter als die Au- gelegenen Sandremise jedoch hoch im Wind ausstreichend in den Park hinein.
Wir jungen Buben durften dabei sein und zusehen, wie die großen Matadore der Vätergeneration – durchwegs mit Schwesterflinten und Lader schießend, weniger ob der hohen Zahl der Vögel, mehr um, der Last des Ladens enthoben, sich völlig auf den Schuss konzentrieren zu können – Triumph und Verzweiflung auf diese Ausnahms-Fasanen erlebten. Denn waren die Auremise-Hahnen sturzschnell, beinah aggressiv und damit höchst herausfordernd, kamen aus der Sandremise solche Fasanen, wie sie Philipp Meran als die schwierigst zu schießenden beschreibt: hoch im Wind über das freie Feld. Kein Anhaltspunkt, wo der Vogel aufzunehmen sinnvollst, wo zu beschießen er am besten wäre. Höchste Konzentration verlangt dieses Ziel vom meisterlichen Könner, verzweifeltes Herumstochern zwängt es dem „ansonsten recht guten“ Schützen auf.
Die Auremise war traditionell der erste Trieb des Tages – dem ein kurzes Präludium vom Schlossteich aufgetriebener Enten vorausging – und siebte da schon umbarmherzig vom Weizen die Spreu. Wer versagt hatte, der war so auf sein Maß zurückgestutzt, dass er in den beiden Trieben der sogenannten Fasanerie, die unterhalb der Auremise im Park lag und wo die Fasanen über hohe Tannen und Fichten getrieben wurden, auch nichts Rechtes mehr zu Wege brachte. Nach dem Mittagessen, dass - gemessen an anderen Jagden beinah frugal, im Hinblick auf das höchste Leistung fordernde Schießen sehr sinnvoll leicht war – folgte der Sandremisen-Trieb. Und hier habe ich hohe und höchste Herren wie kleine Kinder gesehen: entweder nach guter Leistung beseligt lachend wie unter Christbaum, oder verzweifelt wie der Schulerbub, der die erste Fünf nach Haus trägt. Danach kam ein kurzer, aber herausforderndes Treiben über hohe Eichen im Park. Zum krönenden Abschluss aber nahmen die Schützen vor der Barockfassade des Schlosses im Halbbogen Aufstellung, und von dem am Ende der Zentralachse des architektonischen Ensembles gelegenen Meierhofe und just über den Teich der ersten Enten her ging das letzte Treiben des Tages. Im goldüberflammten Licht eines Winterspätnachmittages strichen hohe Vögel die Schützenkette an und fielen vor der Kulisse des Hildebrandt’schen Prachtbaus in weicher Parabel der Erde zu.
War dieser Trieb zu Ende, wich das Licht unweigerlich schnell, wie es in den pannonischen Breiten spätherbstens oder frühwinters halt so ist. Rasch war die Beute des letzten Triebes geborgen und zur Strecke gelegt. Das Tableau fand vor dem Hauptbau des Schlosses statt, eingerahmt von dessen Flügeln ausgerichtet an der Achse und beleuchtet von exakt symmetrisch an den Ecken der Strecke aufgestellten Scheiterhaufen. Dort standen Schützen vorn, Bläser hint', Treiber in der Seiten und rückschauten, tadelten sich, dankten. Stille Strecken waren das, kein Geschnatter und Geprahle. Nacherleben war’s und, ja, Andacht. Dankende Andacht für solchen Tag. Ob sonstwo in Österreich, in Frankreich oder Belgien, selbst in England habe ich keine Jagd als Schütze oder Zuschauer erlebt, die vom Stil, der Darbietung, der formvollendeten Abhaltung dieser Schlossjagd im nördlichen Weinviertel auch nur nahe gekommen wäre. Und damit bin ich nun endlich bei diesem erwähnten seltenen, großen und besonderen Tag angekommen: fünf Jahre schon war ich fort aus dem Weinviertel und wieder nach Hause nach Deutschland übersiedelt, da kam ein Handschreiben meines Ziehonkels und lud mich just auf diese Jagd.
Tags vor dem Termin bereits fuhr ich aus dem Badischen quer durch den deutschen Sprachraum an die mährische Grenze, übernachtete nicht im Zauberschloss, sondern in der nächstgelegenen Wasserburg unterm Buschberg, und als ich andern Morgens auf die Brücke und zum Auto ging, es zu beladen mit den Implementien der Jagd, da war es die langvor erwähnte, resche Luft. Als dann noch auf dem Weg zur Schlossjagd, die Hänge des Waldes herunterfahrend, neben der Straße im Frühlicht ein buntschillernder Fasan hochward und in den Winterhimmel strich, als dann mein Gastfreund sagte: „Ein gutes Omen ist das!“, da war es der perfekte Tag, an dem alles gelingen musste, nichts daneben gehen konnte. Und ließ auch die Au-Remise aus an diesem Tag, strichen die Fasanen nicht steil hinunter in den Schlosspark, sondern bogen halberwegs und übers freie Feld wieder heimzu in den Wald, so hatten doch der ein oder andere Schütze in der Flanke ganz spektakulär schön und hoch anstreichendes Wild, und die Schüsse saßen sauber.
Im ersten Parktrieb dann flogen auch mich die Vögel an. Die ersten vier oder fünf waren recht einfache Schüsse, halb hoch querreitend und nicht überweit weg, und dennoch war’s für die Moral gut, dass alle fünf auf den ersten Schuss sauber fielen und tot waren, ehe sie auf dem Boden aufschlugen. Der nächste Trieb sah mich unweit der Parkmauer am Fuß einer turmhohen, einzeln stehenden und besonders herausgepflegten Fichte. Es war ein Stand seitab der Hauptkette, ein Stand für einzelne, besonders schön fliegende Ausreißer. Und deren kam ein einziger, ein Tenebrosus-Hahn, der von weitem und in großer Höhe meinen Stand anstrich. Mir war er durch den Wipf der Fichte verdeckt, ich hörte nur mehrfaches und schier frenetisches „Tire haut, tire haut“-Rufen, hatte meine Flinte in Bereitschaft schon unter die Achsel geklemmt und schaute mir die Augen aus dem Kopf. Als ich dann endlich diesen einzelnen, winzig scheinenden Hahn sah, geschah es wie von selbst: die Flinte hob sich, ging zur Schulter und an die Wange, der Schuss brach. Und als ich die Flinte wieder abgesetzt hatte, die leere Hülse aus dem rechten Lauf sprang, stürzte der Hahn steintot herab – und direkt auf mich zu. Der mir als Lader zugeteilte Sohn eines der älteren Förster warnte mich mit einem lauten „Obacht“, ich blickte kurz nach oben und konnte gerade noch einen mehr oder minder eleganten Kreuzschritt seitab vollbringen, da lag der Hahn auch schon just an der Stelle, an der ich eben noch gestanden hatte.
Wer es noch nicht erlebt hat: einen Fasan auf den Kopf zu bekommen ist kein Spaß. Es ist mir ein einziges Mal – Gott gedankt – nur gelungen, mir selbst einen Vogel auf den Kopf zu schießen. Das war auf einer sehr gut besetzten Fasanjagd, die den Einsatz eines Flintenpaares zwar nicht zwingend voraussetzte, aber doch recht sinnvoll machte. Ich hatte einen guten Stand und reichlich Anflug schöner Vögel übers freie Feld. Eben war mir eine saubere Doublette gelungen, und ich reichte meinem Lader die leergeschossene Flinte, um eine frisch geladene entgegenzunehmen. Dabei machte ich aber einen kardinalen Fehler, der beim Schießen mit Lader und besonders auf freiem Feld unbedingt vermieden werden sollte: ich drehte mich zu ihm hin und nahm dabei den Blick vom Himmel. Just in der Sekunde bekam ich einen Schlag auf den Kopf, dass ich für einen Moment mehr Sterne sah, als sie in einem besseren Planetarium an die Kuppel projiziert werden. Als ich wieder zu Sinnen kam und mein Lader seinen Lachkrampf überwunden hatte, lag Hahn II aus erwähnter Doublette samt meinem Gehörschutz auf meiner Kappe, denn all das hatte er mir bei seiner Landung auf meinem Haupte mit sich zu Boden gerissen.
Zurück zur besagten Schlossjagd: auch der zweite Vormittagstrieb lief meinerseits wunderbar und ohne Fehlschuss ab, vielleicht auch deswegen, weil mein Gastfreund und oft schärfster Kritiker meiner häufig unzulänglichen Schießkünste nach dem Treib mit dem Fichtenfasan auf mich zugekommen war – er war übernächster Standnachbar gewesen – mit den Worten: „So hab ich Dich noch nie hohe Vögel schießen gesehen!“
Das Mittagessen ließ ich weitestgehend an mir vorüber gehen, und das war bei dem verführerischen, paprikaschwangeren und knoblauchsatten Duft des Kesselgulyas kein leichtes Opfer, weil ich mich nicht durch einen vollen Magen lahm und unbeweglich machen wollte, denn als nächstes stand das Gustostück der Jagd auf dem Plan: die Sandremise. Ich stand als dritter von links in der Schützenkette und damit der heißen Mitte sehr nah, weit unterhalb der Remise. Die Schützen standen in diesem Treiben etliche hundertfünfzig Meter von der Remise entfernt, die Fasanen hatten also scharfe Fahrt und kamen – wie erwähnt – ohne jeden landschaftlichen Anhaltspunkt im freien Himmel daher.
Die ersten drei oder vier Schuss gingen himmelweit fehl, weil ich schlicht nicht wusste, wo ich den jeweiligen Fasan aufnehmen, wie das Ziel ich ansprechen sollte. Dann riss der Flug für einige Minuten ab, und ich hatte die Zeit, mir Gedanken zu machen über das Wie, vor allem über das Wo. In diesen Gedanken zeichnete ich mir ein Fenster in den Himmel, etwa fünfundvierzig Grad über mir, an dessen unterer Kante erst ich den Vogel annehmen wollte. Vorher würde ich mich unterstehen die Flinte überhaupt nur zu heben. Und es gelang. Es fiel natürlich nicht jeder dieser turmhohen Feldfasane. Aber jeder dritte vielleicht packte in meiner Garbe ein, wurde klein und fiel Brust voran zu Boden, so dass ich es nicht nur zufrieden war: ungemein stolz war ich. Und diese Methode des Schussfensters am Himmel habe ich mir für gut besetzte Jagden beibehalten: hat man sich eine solche Stelle gemacht und gemerkt, dann hat man relativ einfache Schüsse zu tun, Körper und Auge lernen die Bewegung und das Bild, das Flinte und Ziel ergeben müssen, recht schnell.
Die beiden Schlusstriebe im Park über die Eichen und dann vor der Barockkulisse des Schlosses waren eitel Wintersonnenglanz. Später dann, vor der vom Flackerschein der Scheiterhaufen umlichterten Strecke, war aus dem Stolz Dankbarkeit geworden für diesen Tag, dieses Fühlen und Erleben. Beim Abendessen und dem langen Beisammensitzen danach war es endlich Freude: tiefe, zufriedene und hellauf lachende zugleich.
Wie ich es weiter vorne erwähnt hatte: solche Tage waren köstliche, wertvolle Seltenheiten. Das Gros meiner Tage auf Fasan, Ente, Taube oder Huhn blieben Krampf und Kampf. Eines Abends, als ich in der väterlichen Gewehrkammer stand und mich einer damaligen Lieblingsbeschäftigung, sprich der gründlichen Inspektion und Reinigung der diversen Waffen samt Schaftpflege, Schraubenkontrolle etc. hingab, fiel mein Blick auf einen Koffer, den ich bis dahin nie so recht beachtet hatte: stählerne Profilschienen, und die Oberfläche von ausnehmend scheußlicher, schwarzer Plastikfolie mit Ledernarbenprägung verkleidet, dazu billige Chromschlösser – gesehen hatte ich das Ding oft, aber neben den segeltuchumkleideten, schweinsledern bezogenen und eichengerahmten gun cases der spanischen Flinten meiner Eltern nahm es sich so übel aus, dass darin eigentlich nur Leere oder übler Schrott sein konnte. Aber weil es halt nun sonst nichts mehr zu tun gab, nahm ich das Ding halt aus dem Regal, um es auf den Werktisch zu heben – und stutze. Der Koffer war voll und wog schwer.
Ich versuchte, die Schlösser zu öffnen, aber sie waren versperrt, und wo der Schlüssel dazu war, das wusste Gott. Vielleicht. In einem Pappkarton unter dem Werktisch fand ich ein ganzes Sammelsurium von Kofferschlüsseln, und das billigste, schlampigst gearbeitete gezahnte Stück Weißblech ließ die Scharnierschlösser aufklappen. Vor mir lag eindeutig ein Flintenpaar, gehüllt in beigen Wollfilz. Ich nahm ein Laufbündel und einen Schaft aus dem Koffer, streifte die Hüllen ab, und hielt die Teile einer bildschöne Seitenschlossflinte in Händen. Schlossbleche und Baskül waren mit feinem Arcanthus-Laub verziert, die Einpassung der Schlösser ins Schaftholz so vorgenommen, dass das Blech nicht in einer planen, hölzernen Rahmung liegt, sondern alles beinah nach „rounded action“ aussieht, die seitlichen Ausläufer des Demibloc der Läufe endlich nicht plan zur Basküle hin abgefeilt, sondern als kleine, ansprechend gravierte und guillochierte Lappen an der Laufwand heraufgezogen. Das Baskül trug den Herstellernahmen „Gambetta“, die Läufe aber waren knapp oberhalb der Lager in geschwungener Schrift mit den Worten „Wirnhier Jagd“ versehen. Gambetta sagte mir damals noch gar nichts, wer der Conny Wirnhier war, das wusste ich genau: Olympiasieger von 1972 auf der Schießanlage Hochbrück, Erfinder der nachmalig ebenfalls olympischen Sportart des Doppeltrap, Ausnahmsschütze und Schießlehrer meines Vaters. Was ich in Händen hielt, das war sein erstes auf ihn gebautes Flintenpaar.
Ich setzte die Flinte zusammen, wog sie in Händen, hob sie, schlug sie endlich an – und sie schien zu liegen. Das war natürlich nun ein völlig Ding der Unmöglichkeit: mein Vater unterragt mich um Haupteslänge, hat dafür einen deutlich breiteren Brustkasten, ist aber zuletzt und zuerst ein Rechtsschütze – und ich bin ein Linker.
Dennoch lag die Schiene sauber zentriert vor meinem Auge. Ich wiederholte den Anschlag, nun auf ein Ziel: wieder war ich sauber drauf. Ein dritter Versuch, diesmal mit geschlossenen Augen, und als ich sie öffnete, da dass das silberne Korn exakt im Scheitel des Schienentrapezes und just an der Unterkante eben des Lichtschalters, den ich fixiert hatte, ehe ich die Augen schloss und die Flinte anschlug. Sie lag.
Noch am selben Abend beschwatzte ich meinen Vater unter etwelchen Whiskys, nächsten Tags auf den nahegelegenen Schießstand seines Schwippschwagers zu fahren, um mal „ALLE im Haus vorhandenen Flinten“ zu beschießen. Ein Paar Garbi, ein Paar Ugartechea, eine Browning-Mitrailleuse, die 16er Kaletztky meines Bruders, meine eigene 16er von Miguel Ugarteburu – und die beiden Wirnhier- Gambettas. Sie hielten auf die anstreichenden Tauben vom hohen Turm das, was sie mir abends in der Gewehrkammer am Lichtschalter versprochen hatten. Und zu Weihnachten, dem fünfundzwanzigsten meines Lebens, da wurden sie mein.
Sie haben mich seitdem auf vielen Jagden begleitet, ihnen fielen bis heute an die 2000 Stück Niederwild – aber bis es soweit war, dass ich verlässlich mit ihnen traf, brauchte es noch einiges an Übung. Und die nahm ich mir zu diesem speziellen Weihnachten gezielt vor. Denn bei einer Buschierjagd in den letzten Dezembertagen dieses Jahres merkte ich, dass ich mit dem neuen Zauberzeug zwar treffen, aber auch ganz gehörig vorbeischießen konnte. Genau dieses Vorbeischießen wollte ich mir – so gut es ging – abgewöhnen.
Ich war damals beruflich ins Badische übersiedelt und suchte nach einem guten Wuftaubenstand. Mit etwas Recherche fand ich heraus, dass die französische Armee für ihre Offiziere und Mannschaften in einem Vorort von Strassburg einen Parcours de chasse unterhielt, genauer gesagt in La Wantzenau – jenem Dörflein, dass den Freunden guter Ganslebern nur allzu bekannt ist.
Dort reiste ich also eines schönen Tages an. Ich sprach damals kaum ein Wort französisch, denn meine Schulzeit war geprägt von Graecum und Latinum, und die junge Dame, die mich die Sprache lehren sollte (und die heute eine liebe, gute und nicht fortzudenkende Freundin geworden ist, Gott und seiner Gnade gedankt), die war noch nicht in mein Leben getreten. Ich radebrach mir also die Erlaubnis zum Mitschießen, lernte ein paar Brocken Französisch und dank eines vom Vater ererbten Dialektohres ein relativ sauberes Elsässisch und fand im „C.T.P.A de La Wantzenau“ endlich Aufnahme und Mitgliedschaft. Auf diesem Stand habe ich während der folgenden zwei Jahre beinahe jeden Mittwochnachmittag und –abend, jeden Samstag und Sonntag verbracht. Das Trainingsprogramm stand fest: fünfzig Tauben Skeet, um beweglich zu werden. Fünfzig Tauben Trap auf 15 Meter im Voranschlag, denn diese Disziplin lehrt wie keine andere, wie das Ziel den Schuss bestimmt. Und endlich 100, an manchen Tagen auch 125 Tauben Jagdparcours. Fünftausend Tauben pro Jahr, das war das minimal festgesetzte Ziel. Und an diesen Trainingsplan hielt ich mich ehern, was keine große Überwindung kostete. Denn zum einen macht das Tontaubenschießen größten Spaß, und zum anderen fand ich unter den französischen Schützen beste Kameraden und Freunde, die jederzeit bereit waren, alle möglichen neuen Stände, Winkel und Kombinationen auszuprobieren. Als ich mit der Zeit mittags wie abends gebeten wurde, am gemeinsamen Dejuner oder Diner teilzunehmen, mit zu essen, zu trinken, zu lachen, da war dieser kleine, feine Verein eine Art Heimat geworden. Merci mille fois, me chers ami, s’ isch e zuggrschöni Zit gesin!
Und neben der „zuggrschöni Zit“ kam noch etwas anderes herum dabei: ich traf mit meinen Gambettas verlässlich. Damals war ich Mitglied der Trumauer Jagdgesellschaft geworden, hatte somit Zugang zu einer sehr guten Niederwildjagd, und dank es Trainings in La Wantzenau stieg mein Patronen-Trefferverhältnis nur an schlechten Tagen über die Grenze von zwei zu eins. Und auf diesen Jagden habe ich begriffen, was die Faszination des rauen Schusses aus glatten Läufen ausmacht. Jagt man mit der Büchse auf der Pürsch, dann ist alles Sinnen dem Herankommen ans Wild gewidmet, dann will, dann muss man nahtlos in der Natur verschwinden, muss Teil des größeren Ganzen werden um in aller Ruhe, überlegt und durchdacht den blitzartig tötenden Schuss anzubringen. Auf der Flintenjagd – wenn es sich um getriebenes Niederwild handelt – ist das anders: auch hier sind Überlegtheit und Durchdachtheit des Schusses kardinal. Aber: man ist Fremdkörper, man wird es immer sein, und was man an innerer Kraft nicht für das Teil-Werden aufwenden muss, das muss man in die Tötung des Wildes legen. Denn man beschießt nicht ein einzelnes Individuum und geht dann mit der Beute nach Hause, man bejagt eine Vielzahl von Lebewesen, und jedes davon, jeder Fasan, jede Taube, jede Ente, jeder Hase muss mit der gleichen Konzentration bejagt und erlegt werden wie der eine Bock, der eine Hirsch, die eine Sau am Ansitz. Gelingt das, schafft man es, das Gelernte und Geübte vorbei an allen Widrigkeiten von Wind, Wetter, Sorgen, anderen Gedanken, Problemen, an allen Hindernissen vorbei in den tötenden Schuss umzusetzen, dann ist es Jagd, dann ist es sauberes Waidwerk. Dann ist es Freude.
Versagt man auf der Pürsch, versagt man beim Einzelschuss auf der Büchse, dann kann es die falsche Optik, der zu gewagte Schuss, das schlechte Licht, das Jagdfieber, dann kann es eine Vielzahl von Gründen gewesen sein, die für den Fehler sorgten.
Bei der Flintenjagd bleibt der Fehler selten allein, und es gibt keine Vielzahl von Gründen aus äußeren und innern Umständen, es bleibt letztlich nur das Versagen des ganzen Jägers, des jagenden Menschen in seiner Gesamtheit. Gelingt es aber, trifft man, dann ist es in der Umkehr die Leistung und - auch das will gesehen und gesagt sein – der Triumph des ganzen Jägers, des jagenden Menschen in seiner Gesamtheit.
Ich habe solche Tage erleben dürfen. Tage großer Niederwildstrecken, an denen kaum ein Schuss oder nur selten einer fehl ging, an denen ich mir mein Fenster am Himmel suchte und es bediente. Solche auch, an denen ich, wenn ich dieses Fenster in allen Winkeln kannte, es verließ und Schüsse weit nach hinten tat, und das von den Nachbarn vierläufig gefehlte, hoch und pfeilschnell fliegende Winterhuhn fiel im Hagel. Tage mit hohen zweistelligen Strecken am Stand, und nach dem Trieb merkte ich, wie die Beine schwankten und die Kondition schwand, weil ich bis zur völligen Verausgabung Schuss um Schuss aus beiden Flinten getan hatte. Aber auch auf kleinstreckigen Jagden, deren Wild aber aufgrund des Geländes und des großen Könnens der Berufsjäger turmhoch und Elends weit draußen strich: querreitende Vögel zwischen dem dritten und vierten Nachbarn, von beiden nach vorn beschossen und gefehlt und nimmer angesehen. Dann der lichtschnelle Gedanke: „Wagst Du’s?“, und hoch ging die Flinte, schwang weit, anhaltslos weit, kontaktlos weit nach vorne, brach der Schuss, fiel das Ziel. So kam der Moment, wo meine Katabasis beginnen musste, mein Fall prädestiniert war, wo ich von mir selber sagte: „Ich bin ein guter Flintenschütze.“
Dieser Moment kam schleichend, und er kam mit meiner Übersiedelung nach England. Zuerst konnte ich – aufgrund der im Vergleich zu Deutschland erheblich strengeren Waffengesetze – meine Gewehre nicht mitnehmen, sondern konnte sie nach einem langwierigen und von schier peinlicher Befragung geprägten Zertifizierungsverfahren erst gut ein Jahr später nachholen. Und dann hatte ich mich endlich glücklich – nicht verliebt, nein, ich liebte glücklich und tu es heute noch und habe dieses Zauberwesen aus der wahrscheinlich größten Gnade heraus, die mein Schöpfer mir geschenkt und zugedacht hat, auch noch heiraten dürfen. Aber das braucht alles seine Zeit: Übersiedeln, Berufswechsel, Hochzeitsvorbereitungen, Hochzeit selbst: Büchse ja, manchmal. Flinte: no way. Glaubt es mir, ich sage es ehrlich: es war kein Opfer, und ich habe noch nicht einmal daran gedacht, dass ich über all das die liebgewonnene Flintenjagd vernachlässigt habe. An das Ans-Flintenschießen-Denken kam ich erst wieder nach der Hochzeit: auf dem Gabentisch, der zu diesem Tag von Freunden und Verwandten in einem Amalthea, Gaia, Eirene und Tyche beschämenden Überreichtum gedeckt wurde, fanden sich auch zwei Handschreiben, die mich ganz besonders, die beste aller denkbaren Ehefrauen aber nur minder freuten: das eine war eine Einladung in die schottischen Borders aus der Hand eines der Trumauer Jagdfreunde, der mich schon viele Jahre zuvor auf den Kleinen Hahn jagdlich beherbergt hatte, das andere aber bat mich in eben jenes Revier in den Cotswolds von Gloucestershire, in dem ich seit etlichen Jahren auf Rehe jagen darf. Beide Einladungen lauteten auf „Pheasants“. Fasane.
In England auf Flugwild geladen werden: gibt es heute irgend etwas, was einem Ritterschlag näher kommt? Unsere Hochzeit hatte im August stattgefunden, und schon im Januar, an zwei aufeinander folgenden Wochenenden waren die Jagdtermine. Den einen davon, den in den schottischen Borders, sagte ich umgehend und dankend zu, meine Freunde in Gloucestershire aber, Georges und Tristan, bat ich um Aufschub. Das hat einen ganz einfachen Grund: ich kannte das Revier zu diesem Zeitpunkt schon recht genau, mit all seinen Hanglagen, seinen Tälern und vor allem mit all seinen Trieben. Somit konnte ich mir grob vorstellen, wie die Vögel dort fliegen würden: hoch. Sehr hoch. Denn beide Jagdherren haben sich der Jagd auf „High Birds“ verschrieben, haben solche auf ihrer eigenen Jagd und reisen zudem jeden Herbst und Winter nach Devon, wo es zwei besonders berühmte Jagden auf solche High Birds gibt: Castle Hill und North Molton. Ich wurde einmal als Begleitung dorthin mitgenommen, und habe gesehen, wie hoch Fasane streichen können, wenn sie richtig getrieben werden – und dass diese Vögel absolut tödlich zu treffen sind, wenn man es gelernt hat. Auf den Jagden in Österreich, auf denen ich bis dahin war, gab es zwar durchaus auch hohe Vögel, aber wenn sie hoch waren, dann waren sie bei fast, in seltenen Fällen und vereinzelt bei mehr als 30 Metern Höhe. Sowohl in Devon als auch in Gloucestershire wären das die niedrigen Vögel gewesen.
In den Cotswolds von Gloucestershire, im Rehparadies, gibt es einen Trieb, den ich exemplarisch beschreiben möchte: er heißt Lime Hill. Dieser Lime Hill grenzt das Tal, in dem das Revier liegt, nach Osten hin ab. Es ist ein steiler Hang mit gut 20 Steigungsprozenten. In der oberen Hälfte ist er mit alten Buchen und Fichten bestockt, dann schließt sich nach unten hin ein siebzig Meter breiter, schwächer geneigter Wiesenstreifen an, hinter dem das Gelände wiederum steil in eine Forstplantage abfällt. Die erste Schützenkette steht auf diesem Wiesenstreifen, gut 50 Meter vom Wald entfernt, der fünfzehn Höhenmeter über den Schützen beginnt. Die nächsten Baumwipfel sind somit mehr als 50 Meter vom Schützen entfernt, und die Fasanen werden noch einmal gute 15 Meter über diese Wipfel hinausgetrieben. Man kann sich nun leicht selbst ausrechnen, in welcher Höhe die Fasane die erste Schützenkette überstreichen. Hinter dieser ersten Kette steht aber noch eine weitere, und hier werden vom Jagdherrn die wahren Meister positioniert, denn sie stehen dreißig Meter hinter und abermals gute zehn und mehr Meter tiefer. Hier sind die Fasanen vollends überturmhoch und stürzen mit atemberaubender Fahrt herab. Hier aber fallen sie, einer um den anderen. Für solche Übungen wollte ich gewappnet sein, und ich wusste, dass mein bisheriges Können das nicht hergab. Ich wollte also zuerst auf die Jagd nach Schottland reisen und dann den Sommer über mit einem Schießlehrer den Schuss auf ganz hohe Ziele üben.
Schottland war traumhaft, von Landschaft und vor allem Gastgeber und Gästen her. Imré W., der Jagdherr, hatte zu dieser Jagd neben einigen seiner ortsansässigen vor allem österreichische und deutsche Freunde und Verwandte geladen, und so war schon der erste Abend ein langes, fröhliches und durchaus whiskyseliges Sitzen, Lachen und Ratschen über gemeinsame, vergangene Jagden in Österreich und Ungarn. Am nächsten Tag, als es zur Jagd ging, war ich trotz der vorangegangenen Nacht fit und motiviert. Und das war dann auch schon alles: ich traf mit meinen vertrauten Gambettas kein Scheunentor, geschweige denn einen Fasan. Die Einfachen nicht, und die Schweren schon gleich nicht. Und schlimmer noch: ich wusste einfach nicht, was ich falsch machte. Ganz selten einmal fiel ein beschossener Vogel herunter. Am nächsten Tag wurde es ein klein wenig besser, und ich kam meinem Problem auf die Spur: denn nun fielen etwas mehr Vögel auf meinen Schuss, aber nur ganz bestimmte. Was mich von vorne hoch anstrich, war seines Lebens sicher. Was nach links flog – für mich als Linksschützen eigentlich er einfachste Schuss – überlebte ebenso. Nur steil und hoch nach rechts streichende Vögel fielen sauber. Leider kamen da die wenigsten. Aber ich wusste jetzt, was los war: man wird nicht jünger, und man wird auch nicht beweglicher. Dieser Umstand und die Tatsache, dass ich wegen des Umzugs nach England deutlich weniger Gelegenheit hatte, die Flinte in die hand zu nehmen, diese beiden Faktoren hatten dafür gesorgt, dass ich mit den Gambettas, die noch auf meinen rechtsschießenden Vater geschäftet waren, einfach nicht mehr zurande kam. Nur bei Schüssen auf die rechts hoch streichenden Vögel schoss der Schaft dahin, wo der Schuss sitzen sollte.
Noch vom Flughafen aus rief ich einen englischen Freund an und fragte um Rat. Er gab mir zwei Adressen: die eine gehörte einem Flintenfachmann namens Nigel Teague, berühmt geworden durch seine hervorragenden Chokes, und nebenbei ein hervorragender Schäfter. Er ließ mich meine Gewehre vier, fünf Mal anschlagen, machte sich dabei Notizen und hieß mich dann in vier Wochen wiederkommen. Für diesen Termin steuerte ich dann auch die zweite Adresse an: eine Schießschule, Ladyswood heißt sie, und der Lehrer ist Michael Pinker. In seiner Schule sollte ich meine Flinten in Empfang nehmen und im Beisein von Lehrer und Schäfter Probeschießen. Nigel Teague hatte zum einen die Schäfte auf mein Maß verlängert, sowohl Senkung als auch Pitch entsprechend hingebogen, aber ich sah auf den ersten Blick, dass die Schränkung immer noch nach rechst lief, und nicht nach links, wie ich es erwartet hatte. Das fiel auch Michael Pinker auf, und er fragte sofort nach dem Grund, da ich ja Linksschütze sei und ergo mit nach rechts gebogenen Schäften überhaupt nicht treffen könne. Nigel winkte ab und sagte nur: „Let’s shoot them and talk later. Lasst sie uns probeschießen, reden können wir danach noch.“
Die Flinten lagen wie zu meinen besten Zeiten, und die Tontauben zerplatzten am Himmel zu rotschwarzem Staub. Nigel grinste sowohl Michael Pinker an und empfahl sich mit den Worten: „ Der Mann hat sein leben lang mit rechtsgeschäfteten Waffen im Linksanschlag geschossen. Hätte ich ihm jetzt einen Linksschaft gebaut, hätte er gar nichts mehr getroffen.“ Ich muss noch einmal dazu sagen: Nigel Teague hatte bei Annahme des Auftrages kein einziges Maß genommen. Keine Schiebelehre, kein Zollstock, kein Maßband war im Spiel. Er sah und wusste. Vor allem aber hatte er gesehen, dass ich mir über die Jahre einen völlig unorthodoxen Anschlag erarbeitet hatte: meine Flinten liegen mit dem Schaftrücken nicht satt an der Backe unterm Jochbein, sondern sie liegen am Kiefer und unterhalb des Kiefermuskels an. So habe ich es mir angelernt, und so treffe ich. Michael Pinker, der Schießlehrer, hat dann an meinem Anschlag nur noch ein Detail geändert: er hieß mich die Laufhand, die ich immer weit vor dem Vorderschaft an den Läufen hatte, für Schüsse über Kopf an den Vorderschaft zurücknehmen, weil ich sonst im Schuss steil nach oben die Läufe nach rechts neben das Ziel zog.
Der Rest war dann Übern am Hohen Turm. In Ladyswood fliegen die höchsten Tauben fünfundfünfzig Meter über Grund. Und sie kommen nur an einer Stelle direkt über Kopf, ansonsten fliegen sie halblinks bzw. halbrechts. Michael Pinker hat mich gelehrt, dass solche Ziele, die auf fast 60 Meter beschossen werden, auch mit einer Querflinte sauber zu treffen sind, er lehrte mich, in welchem Winkel ich solche Ziele als Stichtauben, und ab welchem Winkel ich sie als Querreiter zu beschießen hätte, dass ich rechtsstreichenden hohe Zielen kürzer vorschwingen müsste als linksstreichenden. Neben diesem Wissen nahm ich noch zwei weitere, ungleich erfreulichere Dinge aus seiner Schule mit: einen kleinen Springer Spaniel und die Tatsache, dass meine Frau seitdem auch mit Begeisterung Tontauben schießt.
Nach einigen Monaten regelmäßigen Unterrichts fühlte ich mich fit für die Vögel in den Cotswolds und ließ Georges und Tristan das wissen. Die Reaktion war unisono diese: „Wunderbar, wir planen dich für die Tage X und Y ein – aber lass’ das mit der Schießschule. In einem Jahr ist das nicht erlernbar, komm einfach und versuche, die Tage zu genießen!“ Nun habe ich einmal den deutschen Ansatz der Waidgerechtigkeit, und der gebietet mir nur dann auf Wild zu schießen, wenn ich dem auch gewachsen bin, sprich wenn ich weiß, dass ich das Wild töten kann. Ich ging also insgeheim weiter in die Schießschule und reiste im nächsten Januar, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Debakel in den schottischen Borders in die Cotswolds. Wir waren eine Gruppe von sieben Schützen: Die Jagdherren Tristan und Georges, dazu des letzteren Bruder, ein französischer und ein belgischer Herr sowie zu meiner besonderen Freude ein deutsches Ehepaar vom Niederrhein, beides begeisterte und gute Jäger, die ungemein viel für Wild und Jagd sowohl in Deutschland als auch in Österreich getan haben und tun. Mit beiden ist meine Familie seit langer Zeit in Freundschaft verbunden, mein Vater hatte schon als junger Mann oft in den wildreichen Revieren am Niederrhein gejagt, und ich selbst hatte ein paar Jahre später ebenfalls das große Vergnügen, für einige Tage dort jagen zu dürfen. Nirgendwo in Deutschland habe ich so gepflegte Reviere in einer völlig zersiedelten Landschaft gesehen, und wer mir heute, gegen Ende des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert in Deutschland ein Revier weiß, in dem man auf einem schmalen Wiesenstreifen innert einer dreiviertel Stunde sechzehn Hasen zählt und etliche Fasanen mehr, dazu Rebhühner in echten Ketten, und ums Eck sitzen an vierzig oder sechzig Gänse auf der Stoppel, der sage es mir.
Zurück aber in die Cotswolds: es war die letzte Jagd dieses Jahres, und entsprechend ließ Tristan uns wissen, dass wir keine übermäßig großen Strecken zu gewärtigen hätten, aber es seien schon noch ein paar Ecken da, in denen der ein oder andere Vogel stecken möge. Danach das übliche Losziehen der Standnummern, deren gerade Zahl jeden Trieb die Schützenkette eins heraufsteigt und die ungeraden eins herab. Und dann nahm mich Georges zur Seite und stellte mir meinen Lader vor. Jim begrüßte mich freundlich, fast wie einen alten Bekannten, und dank meines miserablen Namensgedächtnisses musste ich eine Weile lang wühlen, bis es mir klar wurde: in meinem ersten Jahr auf Rehe in England hatten Georges und Tristan mich mit in eine nahegelegen Shooting School genommen, weil sie sich auf die in Kürze aufgehenden Grouse warmschießen wollten. Der Lehrer, unter dessen Ägide auch ich damals einige Schuss getan hatte, das war kein anderer als eben dieser mein Lader Jim. Ein Schießlehrer auf dem Stand, das gibt Ruhe und Sicherheit, und als Jim mir dann auf dem Weg zum ersten Stand auch noch sagte: „Ich habe schon mit Michael Pinker gesprochen, ich weiß Bescheid!“ – ich fühlte mich sicher.
Wer je zum ersten Mal auf einer berühmt guten und schwer zu schießenden Jagd seinen Stand zum ersten Treiben bezogen hat, der wird dieses Gefühl kennen: eine Mischung aus Erwartung, eine hohe und mit Kraft im Zaum zu haltende Motiviertheit und das gepaart mit großem Respekt und letztlich Versagensangst. Da tut es wohl, einen erfahrenen Lehrer an der Seite zu haben: „Nur Ruhe, der Trieb hat gerade erst begonnen. Ich gehe nun seit zwanzig Jahren hier als Lader mit und weiß daher: die ersten Vögel werden unseren Stand in fünfzehn Minuten anstreichen. Bei diesem Licht, diesem Wind und diesem Wetter sind sie zuerst von rechts zu erwarten, gegen Ende werden dann noch ein paar weite Querreiter nach links hinaus kommen, da wir den letzten Stand in der Kette haben. Zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig Fasanen werden uns kommen. Bitte richten Sie sich zuerst auf diese große Eiche im Gegenhang aus, dort werden die ersten Vögel, die für uns beschießbar sind, herausstreichen.“ Ich hätte meine Uhr nach der Präzision dieser Angaben stellen können!
Aber weiß Gott! – diese Vögel waren ein ander Ding als ich es jemals gesehen hatte. Hoch, schnell, weit – und das war noch einer der einfacheren, der Aufwärmtriebe. Ich hatte zu arbeiten, und die ersten Schüsse gingen meilenweit fehl, weil ich zu hastig, zu aufgeregt schoss. Als ich den dritten oder vierten Vogel vorbeigeschossen hatte und mich zu Jim umwandte, ihm meine leere Flinte im Tausch gegen deren geladene Schwester zu reichen, da kam kein Gewehr, sondern der Satz: „Sie bekommen die Waffe erst, wenn sie drei Vögel haben vorbeistreichen lassen und wieder ruhig geworden sind!“ Es half. Der nächste Vogel fiel, ein Fehler, danach eine Doublette gar. Und als dann, als letzter Vogel des Triebes eine Henne unbeschadet vierer Schüsse hoch zwischen meinen Nachbarn durchstrich, als sie dann weit hinter der Kette nach links abdrehte und auf einen gezielten, langsam und ruhig weit nach vorne gezogenen Schuss aus meiner Flinte fiel, als ich diese schon gebrochen hatte und die Patrone aus dem Lager sprang – ich weiß mir wenig Schöneres.
Der nächste Trieb sah mich am selben Stand, denn hatte man zuerst einen steilen Hang etliche sechzig Schritt vor uns getrieben, wurden jetzt die Vögel aus einem Wäldchen, das vierzig Meter hinter uns lag, gedrückt. Meinen nächsten Nachbarn, den erwähnten Herrn und Freund vom Niederrhein, dessen Stand in einer Senke lag, sah ich hier einige prachtvoll hohe Vögel so sauber schießen, dass der schwache Anflug auf meinem Stand alles andere als ins Gewicht fiel. Eine große Jagdfreude wurde mir aber dennoch: mitten in einem größeren Bukett Fasanen, das sich schon weit vor mir nach links und rechts teilte, huschgaukelte ein kleiner, brauner Schatten, wich meinem ersten Schuss nach vorne aus, fiel aber im weichen, weiten Bogen auf die nachgesandte Ladung des zweiten Laufes, und als der Trieb vorbei war, hob ich von der moosüberwucherten Krone einer halbverfallenen Kalksteinmauer Scolopax rusticola auf, den ersten und bis heute einzigen Schnepf meines Lebens.
Für den Nachmittag hatte der Jagdherr zwei besondere Triebe, zwei echte Gustostückerl vorgesehen. Der erste fand in einem breiten Tal statt, über das die Fasanen ein große Strecke zu streichen hatten: vom flushing point bis zur Landung gute drei bis vierhundert Meter über den freien Himmel. In diesem Trieb traf ich wenig bis gar nichts, pudelte und stocherte herum, fand keinen Kontakt zum Ziel, war’s aber deswegen nicht weiter böse, weil ich sowohl zur Linken als auch zur Rechten zwei gute Schützen stehen hatte, denen zuzusehen eine rechte Freude war: ohne Hast und ohne Hektik, fast pomadig und langsam schießend, aber mit großer Präzision und Sicherheit.
Der letzte Tagestrieb sollte dann der schwierigste werden: Eric’s Drive genannt, nach dem verstorbenen Vater des Jagdherrn, der das Gut in den 50er Jahren gekauft und in weiten Teilen zu dem gemacht hatte, was es heute ist. Eric’s findet in einem kleinen Wald statt, der eintausend Meter lang ist, aber seiner Breite nach auf fünfhundert Meter getrieben wird. Diesen Wald durchzieht ein gut sechzig Meter tief eingeschnittener Graben, in dem die Schützen stehen. Ich kam als drittletzter Schütze zu stehen, ganz unten stand der Jagdherr selbst, und zwischen ihm und mir der französische Herr. Ich habe zu Beginn des Treibens ein Photo von ihm gemacht: da steht ein Mensch, die Flinte über der Schulter und auf seinen Zügen ein beinahe verklärtes Lächeln in Erwartung dessen, wovon er genau wusste, wie es kommen würde.
Die Vögel werden in großer Höhe über diesen Graben hinweg getrieben, und dazu herrschten oben auf der Höhe Windgeschwindigkeiten beinahe in Sturmstärke. Die Fasanen kamen so, dass man meinen wollte, sie flögen grade aus und ihrem Stingel nach. In Wirklichkeit aber wehten sie seitwärts dahin. Ich brauchte eine ganze Anzahl von Patronen um dahinter zu kommen, und wirklich fielen gegen Ende des Treibens zwei oder drei dieser – um es mit einem britischen Jagdschriftsteller zu sagen – „soaring archangels“ weit hinter mir und außerhalb des Waldes auf den Acker.
Am nächsten Tag ging es mit dem Schießen noch besser: ich fand den Rhythmus und dank meines ladenden Schießlehrers Jim die Ruhe, um von Anfang an für meine Verhältnisse gut zu schießen. Nur als der Trieb an Lime Hill stattfand, da hob ich die Flinte nur ein oder zwei Mal und merkte dann schnell, dass diese Vögel schlicht außerhalb meiner Reichweite waren. Aber das Zusehen allein machte Freude genug: stillheimlich grinsende Schadenfreude, wenn andere statt meiner Löcher in die Natur stanzten, was hauptsächlich in der ersten Schützenlinie geschah, bewundernde Freude, wenn die Vögel die zweite, erheblich tiefer stehende Linie überstrichen und dort klein zusammenpackten und aus großer Höhe in die dichte Kultur fielen. Was aber beinah noch schöner war, das war den weit unterhalb aufgestellten Hundeführern bei der Arbeit zuzusehen. Sie standen da, links und rechts neben sich bis zu sechs Springer Spaniel aufgereiht, die mit bebender Konzentration auf die fallenden oder ausstreichenden Vögel starrten. War ein kranker Vogel in der Luft, wurde einer der Hunde per Fingerzeig losgeschickt. Der Hund lief dann unter dem kranken Wild einher, den Fasan nie aus dem Auge lassend. Und ging der Vogel endlich zu Boden, dann war in vier von fünf Fällen der Hund schon darüber und hatte ihn aufgenommen. Nur manchmal bedurfte es leichter Richtungskorrekturen durch den Hundeführer – die sämtliche nur durch Handzeichen gegeben wurden – damit der Hund das Wild fand. Darauf ging es wieselflink und unablässig wedelnd zurück zum Führer, dem wurde der Vogel vor die Füße gespuckt, und das Hundl nahm wieder seinen Platz in der Reihe ein.
Ganz selten einmal bin ich nach dem letzten Trieb einer Jagd so glücklich, so rundum zufrieden und froh gewesen wie nach diesen beiden Tagen. Und dass ich auf diese weiß Gott schwer zu treffenden Ziele exakt mein Siebtel zur Strecke beigetragen habe, das hat dazu grade noch geholfen. Denn auch wenn es immer wieder heißt: „Es geht ja nicht um die Einzel-, sondern eher um die Gesamtstrecke, wenn es überhaupt um Strecken geht. Das Wichtigste ist doch, dass man gemeinsam einen schönen tag hatte.“, ich kann das für mich nicht unterschreiben. Denn gerade beim Neiderwild geht es sehr wohl um die Strecke, denn der Jagdherr unternimmt die gewaltige Anstrengung der Ausrichtung einer Jagd inkludierend die dazu gehörige Hege, Rekrutierung von Treiberwehr und Hundeführern, Organisation von Fahrzeugen, Unterkunft, Verpflegung etc. bestimmt nicht nur dafür, dass eine Gruppe seiner Freunde unbeholfen über die Felder stolpert, um dann Löcher in die Luft zu schießen. Nein, er will sein Wild erlegt sehen, er will Strecke sehen. Und daran will ich meinen gerechten Anteil nicht haben, sondern geleistet haben. Das bin ich dem Jagdherrn schuldig.
Weite Hennen, Hohe Gockel
Der raue Schuss aus dem glatten Lauf war mir lange ein siebenfach versiegeltes Buch. Noch heute sind der sieben Siegel nicht alle gelöst und erbrochen, und manchmal deucht es mir, als verschlössen sie sich eines um das andere wieder, um sich dann ungeahnten Momentes überraschend wieder aufzutun. Anfangs stand ich völlig ratlos vor der Flinte. Mit dem gezogenen Lauf, da war das Treffen keine ganz so schwere Angelegenheit: man musste nur Muck und Grinsel genau zusammenschauen, oder – wenn ausnahmsweise auf der Übungswaffe vorhanden – durchs Zielglas sehen, dann die Waffe ruhig halten oder besser noch: auflegen, das war dann schon fast alles. Das Ziel stand ja still. Wie anders dagegen war das Schießen mit der Flinte: da gab’s kein Grinsel für die Muck, nur eine mehr oder minder definierte, und bei den väterlichen Querflinten überhaupt keine Schiene, in deren ungefährer Mitte ein dickes Korn zu platzieren war. Wie sollte man damit einen nur einigermaßen gezielten Schuss abgeben, noch dazu auf ein Ziel, dass nicht nur nicht stillhält, sondern sich mit großer Geschwindigkeit bewegt?
„Vorhalten musst Du“ – „Blödsinn, nicht vorhalten, vorschwingen!“ – „Habt ja allmitsammen keine Ahnung: von hinten ran ans Ziel und im Überholen schießen, so wird das gemacht!“ Die Ratschläge kamen zu aberhunderten, jeder war richtig und keiner half: wann immer mein Vater mir eine seiner feinen spanischen Querflinten am Tontaubenstand in die Hand drückte, gab es bestenfalls eine satte Watschen, und die Taube ging erst dann zu Bruch, wenn sie weit hinter mir unsanft aus den Boden schlug. Der Stand befand sich – goldene Zeiten, da das noch erlaubt war – im Revier eines Onkels, meines Vaters Schwippschwager: in einer steilen Leiten war da auf einen hohen Turm eine Trapmaschine, ein Taumler montiert worden, die die Ziele bald links, bald rechts, bald hoch bad tief warf. Von Zielansprache, vom Lesen der Bahn, vom englischen „how to adress the bird“: keine Red! Schießen sollte ich, nicht dumm fragen, dann würde es schon tun und taugen – irgendwann halt einmal. Und wenn dann gar mein Cousin, ein schneller und sicherer Flintenschütze, antrat, wenn dann eine Taube nach der anderen am Himmel zerplatzte und er wie zum Hohn den zweiten Schuss einem davonschwirrenden Splitter nachsandte, auf dass dieser auch noch zerstäube, wenn ich ihn dann scheu und schüchtern fragte, wie er diese Zauberkunst, diese Magie wirke, dann gab’s als Antwort meist nur: „Du, das kann ich Dir auch nicht genau sagen!“
Was Wunder, dass mich die Flinte lange Zeit nicht reizte. Was heißt: sie schreckte mich graderwegs ab, dieses tretende, schlagende, laute unberechenbare und nicht zu steuernde Schießding. So ging die späte Kindheit dahin und die frühe Jugend: wenn bei irgendwelchen Sejours der jeunesse dorée die ganz verwegenen unter uns, die, die Schlag bei den Mädeln hatten, wenn die die Flinten nahmen um zu brillieren und zu glänzen, da stand ich abseitig und tat als langweilte mich dies Geballere zu Tode, beschäftigte mich mit den Hunden, oder den Büchern oder mit sonst was, damit nur keiner mich fragte: „Bertram, komm, schieß auch einmal! Wie, warum magst Du nicht? Hast Du Angst gar?“
Ich habe an anderer Stelle beschrieben, wie ich im tiefen Niederösterreich meine ersten Schüsse auf Flugwild getan hatte. Und so sehr mir diese für mich gänzlich neue Art zu jagen auch faszinierte: ich war fern der Heimat im Internat, und in den Sommer- oder anderen Ferien gab’s allenfalls das Luftgewehr, und ansonsten Nachhilfe in Mathematik, Englisch und Latein: die Versetzung war wieder einmal gefährdet. Aber auch das war irgendwann vorbei: die Versetzung war nicht mehr gefährdet, sie war unwiderruflich futsch, und das zum zweiten Mal in Folge. Consilium abeundi, Rauswurf, unehrenhafte Entlassung, Versagen! Es war das beste, was mir damals passieren konnte. Als Nichtsnutz, Dummkopf, Faulpelz und Rohrkrepierer war ich zwar gebrandmarkt, aber viel wichtiger: ich konnte dem bis heute innig verhassten Internat und seinen zum Teil unsäglich verlogenen, machtlüsternen und ihre Position missbrauchenden Patres den Rücken kehren, an der Klosterpforte den Staub von meinen Schuhen schütteln und heilige Eide schwören, dass ich nie wieder hierher zurückkehren würde.
Glücklicher Zufall, eher noch gutgöttliche Fügung ersparten mir die Wahrmachung der elterlichen Drohungen von Maturaschule, Militärakademie oder anderen Zuchthäusern: eine entfernte Tante nahm mich unter ihre breiten Fittiche, und so kam ich in eines der jagdlich versiertesten – oder jagdnarrischsten (wobei das nur die ganz Bösen behaupten) – Häuser Österreichs, kam ich ins Weinviertel. In diesem Zauberschloss meiner Jugend gab es genau drei Beschäftigungen für die Zeit, die nicht der Arbeit, oder im Falle der fünf Hauskinder und meiner Wenigkeit, dem Schulstudium gewidmet war: Reiten, Tennis, Jagd. Wobei das Tennis Winters durch Bridge ersetzt wurde. Aber der Reihe nach: Pferde sind wunderbare, schöne, spannende aber letztlich halt doch völlig wilde Tiere. Zum Tennis eignete und eigne ich mich so wie der Esel zum Brezelbacken. Im Kartenspiel bin ich noch schlechter. Es blieb mir nur die Jagd übrig!
Mit der sollte ich keine vierundzwanzig Stunden nach meiner Ankunft bereits konfrontiert werden: es war ein Samstag, und wir Buben – i.e. die beiden ältesten Söhne des Hauses und zwei Söhne eines nahen Nachbarn sowie ich – mussten beschäftigt werden. Und die Beschäftigung war die: ab in die das Haus umgebende Apfelplantage und die Ringeltauben schießen, die mit den von meinem gleichaltrigen Cousin und Klassenkameraden zum pittoresken Zweck der Turmumkreisung gezüchteten weißen Tauben hässliche Hybriden hervorbrachten.
Binnen kürzestem stand die Korona bewaffnet da: der älteste mit einer .410-Repetierflinte, genannt „Pöff“, der zweite mit einem alten Suhler Drilling im Kaliber sechzehn, die Söhne des Nachbarn mit alten Doppelflinten Brünner Bauart. Und mir drückte der Jagdherr – ich war damals noch unbewaffnet – eine schwere Bockdoppelflinte in die Hand, auf deren Laufbündel einerseits stand: Fabrique National, Herstal, Belgique. Auf der anderen Seite stand: Browning B25.
Das war ein ander Gewehr als die kleinen, leichten, kapriziösen spanischen Senoritas meines Vaters! Die hatten nicht mit mir geredet, die hatten mir gedroht, dass sie, würde ich mit meinen plumpen Dummjungenhänden sie nicht richtig anpacken, mir das Gesicht rot und blau prügeln würden, mich auslachen würden ob meiner Tollpatschigkeit – und jedes Mal hatten sie das Versprechen wahr gemacht, hatten mich wissen lassen, dass sie Rassegeschöpfe seien, von Männerhand nur zum Schönsten zu führen, nicht von dummer Buben Pratzen. Wie anders aber diese ehrwürdige Matrone aus Lüttich. Sie wog beruhigend schwer in meinen Händen, sie versprach mir, dass nicht ich sie, nein, dass sie mich schon recht führen würde. Keine Drohung gab es, nur das Angebot: ‚Lass’ es uns versuchen miteinander. Und wenn Du mich machen lässt, dann wird’s schon werden!’
Die beiden Söhne meines Jagdherrn wussten genau, wo die Flugrouten der Tauben verliefen, und wie sie je nach Wind und Wetter angenommen wurden. An der Südwestseite des Hauses nahmen wir Posten, unser fünf Flinten im Abstand von je gut dreißig Schritt deckten die breite Front gut ab. Es war kein langes Warten, bis die erste Taube hoch über dem Dach erschien. Und hoch über dem Dach hieß: weit weg von uns. Ich habe es mir aus dem Gedächtnis und nach Photos einmal aussummiert: Das Haus, eine alte Burg, steht auf einem Hügel, der an unserer Flanke einen Niveau-Unterschied von guten fünfzehn Metern ausmachte. Das Haus selbst war an dieser Stelle weitere zehn Meter hoch, somit war dieser Vogel von uns aus sichere dreißig wenn nicht mehr Meter über Grund. Und er flog pfeilgerade auf meinen Stand zu. Von links und rechts schallte mir mehrstimmig das „Tire haut!“ in die Ohren. Ohne lang zu überlegen hob ich die schwere Browning-Flinte. Und dann geschah etwas, was ich heute noch in meinen Händen spüren kann: das Gewehr bewegte sich, als hätte es eigen Sinn und Leben, schwang von hinten auf das Ziel, darüber hinaus noch und wollte und wollte nicht aufhören zu schwingen. Irgendwann – und für mein damaliges Denken viel, viel zu spät – zog ich am Züngel, in der festen Überzeugung himmelweit vor der Taube vorbeigeschossen zu haben.
Und als ich die Waffe absetzte, fiel der Vogel steintot vom Himmel herab und landete weit hinter mir im Gebüsch. Das lobende „Bravo“ der anderen hörte ich gar nicht recht, ich war immer noch zu sehr mit dem eben Erlebten beschäftigt: die Flinte hatte das Angebot, dass sie mir stumm und nur durch ihr schwer-behäbiges Wesen unterbreitet hatte, tatsächlich wahrgemacht: ‚Wenn Du mich machen lässt, dann wird’s wohl geraten.’ Und geraten war es, wie durch Zauberhand.
Konnte das denn sein, das ein Gewehr ganz allein, mehr oder minder ungeführt solche Schüsse tat? Heute weiß ich, dass es nicht die Waffe allein war, sondern ein geglücktes Zusammenspiel meiner Unerfahrenheit und einer gut schwingenden, perfekt balancierten Flinte. Ich hatte damals noch nicht den verzweifelt-verkrampften Wunsch, unbedingt treffen zu wollen, der alles, aber auch alles am Flintenschießen zunichte macht. Ich wollte einfach nur keine Watschen von dem Schießprügel bekommen, und drum hatte ich so spät erst den Abzug betätigt, spät genug, um weit genug vor der hohen und schnellfliegenden Taube zu sein. Dahin hatten mich aber das Gewicht und die gute Balance dieser Waffe gebracht.
Ein perfekter Flintenjäger ist aber aus mir in diesem ersten Schuss beileibe nicht geworden, das zeigte sich schon wenige Minuten später: eine andere Taube hatte sich in einen hohen Baum etwa 25 Meter schräg rechts vor mir gestellt, und mein Schützennachbar, der direkt vor dem Baum stand, hieß mich einen Hebschuss tun, damit der Vogel hoch würde und er ihn schießen könne. Das war nun eine Aufgabe, der ich mich dank intensiver (aber meist erfolgloser) Luftgewehrjagd durchaus gewachsen fühlte. Und aus dieser erwähnten Erfahrung heraus wusste ich: eine Taube steht vom bloßen „Patsch“ eines Luftgewehres nicht auf, sie muss das Diabolo-Kügerl schon durch die Blätter prasseln hören, um sich auf die Schwingen zu machen. Ich zielte also – genau wie mit meinem Luftbüchsle – etwas unterhalb des Vogels, drückte ab, und auch diese Taube fiel mitten in der Schrotgarbe steintot zu Boden. Diesmal gab es kein „Bravo“, sondern nur ein sehr trockenes: „Danke sehr, das Totschießen hättest Du mir jetzt nicht abnehmen müssen!“ von meinem Standnachbarn.
Die „EffEnn“, wie diese Flinte hausintern genannt hatte, wo jedes Gewehr seinen Namen hatte, diese FN also wurde während meiner Zeit dort so etwas wie mein Dienstgewehr. Eine eigene Waffe hatte ich nicht, und somit war diese Flinte meine Begleiterin auf den Reviergängen, zu allererst aber Übungsgewehr: der Jagdschein stand an erworben zu werden. In der nahen Bezirkshauptstadt gab es einen Schießstand mit Trap, Skeet und Jagdparcours, und was ich an Taschengeld hatte, beziehungsweise was ich Sommers im väterlichen Forst bei Seilbahn, Klupprotte und Pflanzerei dazuverdient hatte, das trug ich dorthin und investierte es in Schrotpatronen und Tontauben. Und damit begann die eigentliche Misere.
Anstatt so zu treffen, wie ich es beim ersten Schuss mit der FN getan hatte – nämlich frei von Hirnmarterei und Denken – wollte ich ab dato unbedingt treffen. Das gelang halt nur selten. Und wie es schon so ist: auf jedem Schießstand gibt es ein paar Bezirksweltmeister, die sich für die geborenen Schießlehrer halten und mit ihren Ratschlägen, die für den Anfänger bei weitem nicht so gut sind, wie sie gemeint waren, freigiebigst mich bedachten. „Vorne vorbei, hinten vorbei, drüber, drunter. Drauf musst Du schießen. Und weiter vor!“
Was nun? Drauf und Vor sind zwei topographisch klar voneinander getrennte Punkte, und dass ich an der Taube vorbeigeschossen hatte, das konnte ich Mal für Mal genauestens sehen. Sie blieb ja heil. Wenn aber einmal glücklich eine Taube zersprang, dann hieß es: „Jetzt hast Du alles richtig gemacht!“ Und damit wurde man dann stehen ge-, sowie seiner Verzweiflung überlassen. Erst viele Jahre später, zuerst in Buke bei Heinz Oppermann und dann in Großbritannien bei Michael Pinker lernte ich, was richtiger Schießunterricht bedeutet: einen Menschen an der Seite haben, der die Garbe im Flug sehen kann, und den Schützen nicht mit der wenig weiterführenden Information über den klar ersichtlichen Fehlschuss langweilt, sondern ihm die Haltung, den Anschlag, den Schwung korrigiert, ihm den richtigen Gebrauch und die rechte Position der Führhand am Vorderschaft weist, ihm die absolute Wichtigkeit der richtigen Fußstellung und der Beinarbeit beibringt.
Vieles kann man übers Flintenschießen in Büchern lesen. Fürstenberg, Meran, McDonald-Hastings, Nickerson, Oppermann haben alle hervorragendes dazu geschrieben. Am meisten habe ich allerdings aus dem Buch des Flintenschmieds Robert Churchill gelernt: „Game Shooting: The Definitive Book on the Churchill Method of Instinctive Wingshooting for Game and Sporting Clays“, zu Deutsch schlicht: „Das Flintenschießen“. Was dieser große Praktiker und Könner an Wissen in dieses Buch gelegt hat, ist ein Schatz, den zu bergen einem jeden Flintenschützen dringendst angeraten sei. Speziell seine fast unfehlbare Methode eines immer exakt wiederholgenau zu reproduzierenden Anschlags ist ebenso genial wie einfach: er schreibt vor, den Schaft der Flinte in Erwartung des Schusses nicht an der Seite oder gar am Hüftknochen zu halten, wie es der deutsche Funktionärsanschlag verlangt, sondern ihn fest unter die Achsel zu klemmen, zwischen Oberarm und Rippen zu fixieren und dann, wenn die Flinte ins Gesicht soll, sie mit beiden Händen nach vorne zu schieben und zu heben. Wem das nun etwas seltsam vorkommt, der möge es probieren und dabei im Spiegel genau seine Schulter beobachten. Durch diese Bewegung geht der Schaft nämlich nicht an die Schulter, es ist genau umgekehrt: die Schulter geht an den Schaft! Dieser Anschlag ist so wiederholgenau wie eine gute Zielfernrohrmontage, und hat nebstbei den großen Vorteil, dass er eine blaugeschossene Schulter ausschließt. Denn dadurch, dass nicht die Flinte nach hinten an die Schulter, sondern die Schulter nach vorne an den Schaft geht, ist dem Rückstoß ein optimales, schockabsorbierendes Widerlager geboten.
Doch so klug und weise alles ist was in den genannten Büchern geschrieben steht: zur Umsetzung in die Praxis bedarf es entweder großen Talentes oder aber eines Lehrers. Beides hatte ich nicht. Besuche auf dem Schießstand waren also immer von geteiltem Erfolg, je nach Tagesform mal mehr, meist weniger reich an Treffern. Die Jagd auf Flugwild dagegen war über viele Jahre völliges Debakel. Zum unbedingten und verkrampften Treffen-Wollen kam noch die Aufregung, kam das Jagdfieber dazu. Die Einladungen, die Gelegenheiten auf Flugwild zu jagen waren wenige, damit konnte ich mir die für diese Jagd so dringend notwendige Routine nicht zulegen. Meine Schießkünste blieben gering, und damit war’s ein fertiger circulus vitiosus: Wer schlecht schießt, wird selten eingeladen. Wer selten eingeladen wird, hat wenig Übung auf Wild. Wer wenig Übung auf Wild hat, schießt schlecht. Nur manchmal gelang es, einen einzelnen weiten und hohen Vogel, Taube, Ente, Fasan, so tödlich zu treffen, wie es den großen Könnern mit Regelmäßigkeit gelang.
Soviel Theorie ich auch paukte, ich wurde dadurch lediglich theoretisch ein guter Schütze. Und sah neidvoll den anderen, den tatsächlich guten Schützen zu, wie sie einen mir gänzlich unerreichbaren Vogel nach dem anderen mit sauber tötenden Schüssen herunterholten. Ich stand dann da, mit meiner vom Vaterbruder ererbten, langen, schlanken und wunderhübschen 16er Spanierin - und hoffte inständig um KEINEN Anflug, damit ich mich ja nicht blamieren würde.
Ganz selten aber gab es Tage, die unter einer Konjunktion bester Sterne standen. Tage, an denen es völlig wurscht war, ob man abends zuvor zeitig und nüchtern zu Bett gegangen war oder im Suri bis zum Morgengrauen gedraht hatte. Tage, deren Morgenluft nicht wie Champagner prickelte, sondern wie einer der ganz großen, ganz guten österreichischen Weißweine – Grüner Veltliner meinethalb oder Welschriesling – moussierend, frisch, jung, frech, mit einem Wort: resch war. Und stand ich solchen Tags am Stand, da verlangte ich nicht nach dem ersten Vogel, da brannte ich darauf. Kam er dann, ging die Flinte von allein ihren Weg in Schulter und Gesicht, folgte von selbst im Hochnehmen schon der Bahn des Ziels, schwang von sich aus in den richtigen Bereich. Ich musste nur noch abdrücken, und das Wild fiel prachtschillernd und im weiten Bogen zur Erde.
Aus der frühen Zeit, als ich noch meine 16er führte, da ist mir ein solcher Tag besonders erinnerlich. Aber dafür muss ein wenig ausgeholt sein. Als Schüler, Hauskind und Gast im Zauberschloss im Weinviertel war – neben der einen oder anderen Stampereinladung – der niederwilde Höhepunkt das Bauernjagdl: da wurden die Felder, Gräben und Hecken des „Hean Grof“ und die der Jagdgenossenschaft in einer großen, ungemein lustigen und buntstreckigen Jagd genommen. Und weil diese Jagderln einen so besonderen Reiz hatten, lieber Leser, schenk mir ein wenig Geduld und lass mich eine davon beschreiben, bevor ich zu diesem besonderen, reschen Tag komme.
Ich war damals schon aus dem Zauberschloss in (Vorsicht: strapazierter Ausdruck!) meine erste mit Bett, Küche, Sofa, Tisch und gelegentlich auch Damenbesuch möblierte Mansarde gezogen, und saß dort - bestimmt nicht über Lateinstudien, sondern über irgendeinem Gagern oder Meran, mag auch das „Niederösterreichische Weidwerk“ aktueller Ausgabe gewesen sein, Pfeiferl im Maul, Glas mit vom Vater aus dem gewissen Fass stibitzen Whisky darnebst und Schubert, Schumann oder eher noch Mendelssohn im Ohr – als das Telefon klingelte. Der Ziehonkel hieß mich, des soundsovielten currentis, id est Novembris, zu der erwähnten Bauernjagd zu kommen. Das „Selbstverständlich, und gern!“ war Pflicht, Freud und Ehr gleichermaßen. War’s auch kein großes Niederwildschlachten, und hatte man einen Hahn zur Strecke, dann lag man schon über dem Durchschnitt: allein der Figuren wegen, die dem Wesen und den Gesichtern nach grad so gut hätten dem Petermann'schen Jagdbuch entsprungen sein mögen, allein das war es hoch derwert. Und zudem jagte man auf echtes Wild: Fasanen, die schon manches Schrot hatten prasseln hören, die gewitzt waren und sich gockend prasselnden Schwingenschlags senkrecht in die Höh’ schraubten, um dann still und schnell am winterblitzblauen Firmament über die schneebedeckten Schollenäcker der Kellergasse oder dem Katzengraben, der Sandgube oder gar dem Dorf zuzustreichen, salutiert von einem Reihenpeloton, wie er in Präzision und Taktung auch nach schärfstem Üben von der Royal Horse Artillery zum Geburtstag der Queen im Green Park zu London nicht besser geschossen wird. Und so wie Ihre Majestät dazu verbindlich lächelt, so lachte sicher auch der jeweilige Gockel, wenn er sicher und weit hinter der Schützenkette mit den leinenzerrenden Hunden den gefrorenen Löß unter seine Ständer nahm.
„Neun Uhr Treffpunkt im Meierhof!“, hatte es geheißen, und selbstverständlich war man eine halbe Stunde früher da, ebenso selbstverständlich begann die Ansprache des Jagdleiters frühestens eine halbe Stunde nach dem Treffpunkttermin: Ratschen, Rauchen Lachen. Gewehre vergleichen, angeben mit dem neuen Zauberzeug, erst recht dafür aufgezwickt werden. Scheu schauen, ob all die alten Gesichter von „feant“, vom letzten Jahr auch da sind. Still trauern um einen oder zwei, deren Grab auf dem Friedhof die letzen Brüche decken.
„Sad’s endlich ålle då? A Ruah!“ Kurze Fanfare aus einer zerbeulten Kavallerietrompete. „Fasauna schoiß ma heit, Håhna netto, wisst’s as eh. Hås, Künigl, Raubzeigs. Oisdaunn, Weidmanns Heul!“ – „Momenterl!“, meldet die Kavallerietrompete, i.e. der Herr Graf: „Heuer geben wir auch Schweinderln frei bis fuchzig Kilo. Sind ein oder zwei Triebe, wo welche drin sein können.“ Hektisches Abklopfen sämtlicher Jackentaschen: Brenneke dabei? „I hob kane, Du?“ – „I ah ned. Fråg in Bäck, `leicht hod der wås dabei!“ Der Bäck, Wirt im Nachbardorf, grinst. Er hat.
Erster Trieb: Schottergrube. Sommers zwei Jahre davor hatte ich – quasi in der post Jagdprüfung angesetzten praktischen Ausbildung im Fach „Reviereinrichtung“ mittels in einem anderen Revierteil geschnittener, per Moped herangefahrener und dann mühselig in die abrutschgefährdeten Sandwände getriebener Salweiden Erosionsschutz und Deckungsbau betrieben. Die Weidenhecke war gut hochgekommen, vielleicht zahlte sie sich heuer aus. Treiber rein! Von meinem Stand aus sehe ich die Karnickel unbeschossen in Sicherheit flitzen. Wild ist also drinnen. Zwei Hasen flüchten auf den Acker hinaus. Einen rouliert der Nachbar, der andere schlägt auf meinen Schuss das Radl. Dann lange nichts. Ganz zum Schluss steht ein richtiges Bukett Fasanen auf, steil und sehr hoch. So hoch, dass keiner die Flinte hebt. Plötzlich ein rascher Doppelschuss, und zwei Hahnen fallen, klein zusammengepackt in den schneeigen Acker. Großes Raunen und Fragen: „Wer war das?“ Draußen, ganz am Rand der Schottergrube klappt der alte Gock Bauernfeind sein Gewehr auf, nimmt zwei leergeschossene Papphülsen heraus und grinst unter seiner großen Hakennase.
Und so und anders geht es Feld um Waldl fort und fort, hier zwei Hahnen, dort ein Has. Zu Mittag dann heiße Würstl Frankfurter und Debrecziner Machart, Glühmost dazu, „Alsdann, påck ma’s wieda aun!“. Ein halbes Dutzend Hasen liegt am Abend zur Strecke, zwei Dutzend Hahnen. Ja, eine Henn’ auch. Und um halber sechse ist der Schüsseltrieb beim Bäck! Gern wär’ ich noch einmal dabei.
Dann gab es aber Jahr um Jahr noch einen anderen, für uns Jungen nur passiven, dafür aber nicht minder herbeigesehnten Höhepunkt im Jagdjahr: die große, die Schlossjagd. Das Schloss aber, um das sie spielte, das war nicht das erwähnte und beschriebene Zauberschloss, das war der stolze und familiennamengebende Stammsitz des Hauses, erbaut im hohen Barock für den damaligen Fürsterzbischof und Vizekanzler des Heiligen Römischen Reiches. Ein Versailles für sich, hingebettet in einen weitläufigen Park voll hoher Eichen, gelegen zwischen zwei Hügeln, deren jeder obern auf der Krone eine dichtgepflanzte und alterslang gepflegte Remise trug.
Die Namen dieser Remisen hatten hohen und verheißungsvollen Klang unter den großen Flintenschützen früherer Jahre: Auremise und Sandremise hießen die Triebe, Szápáry, Bulagrini, Széchenyi, Traun, Saurma die Schützen . Und wann immer ich als junger Kerl einen der alten Herren traf, die zu dieser Generation gehörten: unweigerlich lösten diese beiden Ortsnamen verklärt-verzückte Minen aus. Entweder hatten sie selbst dort geschossen, oder diese beiden Treibe waren ihnen lebenslang unerreicht und damit umso köstlicher geblieben. Selbst mein Großvater, der bis ins hohe Alter schnell und tödlich sicher seine Flinten führte, kannte diese Triebe gut und schätzte die Tage hoch, an denen er sie geschossen. Sechzig Meter über dem Niveau des Schlossparks liegt die erstgenannte, zwar nur dreißig Meter, aber weit davon weg die zweite der beiden Remisen. Und die Vögel, die daraus getrieben werden, stürzen sich von der höheren pfeilschnell und tauchend, von der zwar niedriger, aber weiter als die Au- gelegenen Sandremise jedoch hoch im Wind ausstreichend in den Park hinein.
Wir jungen Buben durften dabei sein und zusehen, wie die großen Matadore der Vätergeneration – durchwegs mit Schwesterflinten und Lader schießend, weniger ob der hohen Zahl der Vögel, mehr um, der Last des Ladens enthoben, sich völlig auf den Schuss konzentrieren zu können – Triumph und Verzweiflung auf diese Ausnahms-Fasanen erlebten. Denn waren die Auremise-Hahnen sturzschnell, beinah aggressiv und damit höchst herausfordernd, kamen aus der Sandremise solche Fasanen, wie sie Philipp Meran als die schwierigst zu schießenden beschreibt: hoch im Wind über das freie Feld. Kein Anhaltspunkt, wo der Vogel aufzunehmen sinnvollst, wo zu beschießen er am besten wäre. Höchste Konzentration verlangt dieses Ziel vom meisterlichen Könner, verzweifeltes Herumstochern zwängt es dem „ansonsten recht guten“ Schützen auf.
Die Auremise war traditionell der erste Trieb des Tages – dem ein kurzes Präludium vom Schlossteich aufgetriebener Enten vorausging – und siebte da schon umbarmherzig vom Weizen die Spreu. Wer versagt hatte, der war so auf sein Maß zurückgestutzt, dass er in den beiden Trieben der sogenannten Fasanerie, die unterhalb der Auremise im Park lag und wo die Fasanen über hohe Tannen und Fichten getrieben wurden, auch nichts Rechtes mehr zu Wege brachte. Nach dem Mittagessen, dass - gemessen an anderen Jagden beinah frugal, im Hinblick auf das höchste Leistung fordernde Schießen sehr sinnvoll leicht war – folgte der Sandremisen-Trieb. Und hier habe ich hohe und höchste Herren wie kleine Kinder gesehen: entweder nach guter Leistung beseligt lachend wie unter Christbaum, oder verzweifelt wie der Schulerbub, der die erste Fünf nach Haus trägt. Danach kam ein kurzer, aber herausforderndes Treiben über hohe Eichen im Park. Zum krönenden Abschluss aber nahmen die Schützen vor der Barockfassade des Schlosses im Halbbogen Aufstellung, und von dem am Ende der Zentralachse des architektonischen Ensembles gelegenen Meierhofe und just über den Teich der ersten Enten her ging das letzte Treiben des Tages. Im goldüberflammten Licht eines Winterspätnachmittages strichen hohe Vögel die Schützenkette an und fielen vor der Kulisse des Hildebrandt’schen Prachtbaus in weicher Parabel der Erde zu.
War dieser Trieb zu Ende, wich das Licht unweigerlich schnell, wie es in den pannonischen Breiten spätherbstens oder frühwinters halt so ist. Rasch war die Beute des letzten Triebes geborgen und zur Strecke gelegt. Das Tableau fand vor dem Hauptbau des Schlosses statt, eingerahmt von dessen Flügeln ausgerichtet an der Achse und beleuchtet von exakt symmetrisch an den Ecken der Strecke aufgestellten Scheiterhaufen. Dort standen Schützen vorn, Bläser hint', Treiber in der Seiten und rückschauten, tadelten sich, dankten. Stille Strecken waren das, kein Geschnatter und Geprahle. Nacherleben war’s und, ja, Andacht. Dankende Andacht für solchen Tag. Ob sonstwo in Österreich, in Frankreich oder Belgien, selbst in England habe ich keine Jagd als Schütze oder Zuschauer erlebt, die vom Stil, der Darbietung, der formvollendeten Abhaltung dieser Schlossjagd im nördlichen Weinviertel auch nur nahe gekommen wäre. Und damit bin ich nun endlich bei diesem erwähnten seltenen, großen und besonderen Tag angekommen: fünf Jahre schon war ich fort aus dem Weinviertel und wieder nach Hause nach Deutschland übersiedelt, da kam ein Handschreiben meines Ziehonkels und lud mich just auf diese Jagd.
Tags vor dem Termin bereits fuhr ich aus dem Badischen quer durch den deutschen Sprachraum an die mährische Grenze, übernachtete nicht im Zauberschloss, sondern in der nächstgelegenen Wasserburg unterm Buschberg, und als ich andern Morgens auf die Brücke und zum Auto ging, es zu beladen mit den Implementien der Jagd, da war es die langvor erwähnte, resche Luft. Als dann noch auf dem Weg zur Schlossjagd, die Hänge des Waldes herunterfahrend, neben der Straße im Frühlicht ein buntschillernder Fasan hochward und in den Winterhimmel strich, als dann mein Gastfreund sagte: „Ein gutes Omen ist das!“, da war es der perfekte Tag, an dem alles gelingen musste, nichts daneben gehen konnte. Und ließ auch die Au-Remise aus an diesem Tag, strichen die Fasanen nicht steil hinunter in den Schlosspark, sondern bogen halberwegs und übers freie Feld wieder heimzu in den Wald, so hatten doch der ein oder andere Schütze in der Flanke ganz spektakulär schön und hoch anstreichendes Wild, und die Schüsse saßen sauber.
Im ersten Parktrieb dann flogen auch mich die Vögel an. Die ersten vier oder fünf waren recht einfache Schüsse, halb hoch querreitend und nicht überweit weg, und dennoch war’s für die Moral gut, dass alle fünf auf den ersten Schuss sauber fielen und tot waren, ehe sie auf dem Boden aufschlugen. Der nächste Trieb sah mich unweit der Parkmauer am Fuß einer turmhohen, einzeln stehenden und besonders herausgepflegten Fichte. Es war ein Stand seitab der Hauptkette, ein Stand für einzelne, besonders schön fliegende Ausreißer. Und deren kam ein einziger, ein Tenebrosus-Hahn, der von weitem und in großer Höhe meinen Stand anstrich. Mir war er durch den Wipf der Fichte verdeckt, ich hörte nur mehrfaches und schier frenetisches „Tire haut, tire haut“-Rufen, hatte meine Flinte in Bereitschaft schon unter die Achsel geklemmt und schaute mir die Augen aus dem Kopf. Als ich dann endlich diesen einzelnen, winzig scheinenden Hahn sah, geschah es wie von selbst: die Flinte hob sich, ging zur Schulter und an die Wange, der Schuss brach. Und als ich die Flinte wieder abgesetzt hatte, die leere Hülse aus dem rechten Lauf sprang, stürzte der Hahn steintot herab – und direkt auf mich zu. Der mir als Lader zugeteilte Sohn eines der älteren Förster warnte mich mit einem lauten „Obacht“, ich blickte kurz nach oben und konnte gerade noch einen mehr oder minder eleganten Kreuzschritt seitab vollbringen, da lag der Hahn auch schon just an der Stelle, an der ich eben noch gestanden hatte.
Wer es noch nicht erlebt hat: einen Fasan auf den Kopf zu bekommen ist kein Spaß. Es ist mir ein einziges Mal – Gott gedankt – nur gelungen, mir selbst einen Vogel auf den Kopf zu schießen. Das war auf einer sehr gut besetzten Fasanjagd, die den Einsatz eines Flintenpaares zwar nicht zwingend voraussetzte, aber doch recht sinnvoll machte. Ich hatte einen guten Stand und reichlich Anflug schöner Vögel übers freie Feld. Eben war mir eine saubere Doublette gelungen, und ich reichte meinem Lader die leergeschossene Flinte, um eine frisch geladene entgegenzunehmen. Dabei machte ich aber einen kardinalen Fehler, der beim Schießen mit Lader und besonders auf freiem Feld unbedingt vermieden werden sollte: ich drehte mich zu ihm hin und nahm dabei den Blick vom Himmel. Just in der Sekunde bekam ich einen Schlag auf den Kopf, dass ich für einen Moment mehr Sterne sah, als sie in einem besseren Planetarium an die Kuppel projiziert werden. Als ich wieder zu Sinnen kam und mein Lader seinen Lachkrampf überwunden hatte, lag Hahn II aus erwähnter Doublette samt meinem Gehörschutz auf meiner Kappe, denn all das hatte er mir bei seiner Landung auf meinem Haupte mit sich zu Boden gerissen.
Zurück zur besagten Schlossjagd: auch der zweite Vormittagstrieb lief meinerseits wunderbar und ohne Fehlschuss ab, vielleicht auch deswegen, weil mein Gastfreund und oft schärfster Kritiker meiner häufig unzulänglichen Schießkünste nach dem Treib mit dem Fichtenfasan auf mich zugekommen war – er war übernächster Standnachbar gewesen – mit den Worten: „So hab ich Dich noch nie hohe Vögel schießen gesehen!“
Das Mittagessen ließ ich weitestgehend an mir vorüber gehen, und das war bei dem verführerischen, paprikaschwangeren und knoblauchsatten Duft des Kesselgulyas kein leichtes Opfer, weil ich mich nicht durch einen vollen Magen lahm und unbeweglich machen wollte, denn als nächstes stand das Gustostück der Jagd auf dem Plan: die Sandremise. Ich stand als dritter von links in der Schützenkette und damit der heißen Mitte sehr nah, weit unterhalb der Remise. Die Schützen standen in diesem Treiben etliche hundertfünfzig Meter von der Remise entfernt, die Fasanen hatten also scharfe Fahrt und kamen – wie erwähnt – ohne jeden landschaftlichen Anhaltspunkt im freien Himmel daher.
Die ersten drei oder vier Schuss gingen himmelweit fehl, weil ich schlicht nicht wusste, wo ich den jeweiligen Fasan aufnehmen, wie das Ziel ich ansprechen sollte. Dann riss der Flug für einige Minuten ab, und ich hatte die Zeit, mir Gedanken zu machen über das Wie, vor allem über das Wo. In diesen Gedanken zeichnete ich mir ein Fenster in den Himmel, etwa fünfundvierzig Grad über mir, an dessen unterer Kante erst ich den Vogel annehmen wollte. Vorher würde ich mich unterstehen die Flinte überhaupt nur zu heben. Und es gelang. Es fiel natürlich nicht jeder dieser turmhohen Feldfasane. Aber jeder dritte vielleicht packte in meiner Garbe ein, wurde klein und fiel Brust voran zu Boden, so dass ich es nicht nur zufrieden war: ungemein stolz war ich. Und diese Methode des Schussfensters am Himmel habe ich mir für gut besetzte Jagden beibehalten: hat man sich eine solche Stelle gemacht und gemerkt, dann hat man relativ einfache Schüsse zu tun, Körper und Auge lernen die Bewegung und das Bild, das Flinte und Ziel ergeben müssen, recht schnell.
Die beiden Schlusstriebe im Park über die Eichen und dann vor der Barockkulisse des Schlosses waren eitel Wintersonnenglanz. Später dann, vor der vom Flackerschein der Scheiterhaufen umlichterten Strecke, war aus dem Stolz Dankbarkeit geworden für diesen Tag, dieses Fühlen und Erleben. Beim Abendessen und dem langen Beisammensitzen danach war es endlich Freude: tiefe, zufriedene und hellauf lachende zugleich.
Wie ich es weiter vorne erwähnt hatte: solche Tage waren köstliche, wertvolle Seltenheiten. Das Gros meiner Tage auf Fasan, Ente, Taube oder Huhn blieben Krampf und Kampf. Eines Abends, als ich in der väterlichen Gewehrkammer stand und mich einer damaligen Lieblingsbeschäftigung, sprich der gründlichen Inspektion und Reinigung der diversen Waffen samt Schaftpflege, Schraubenkontrolle etc. hingab, fiel mein Blick auf einen Koffer, den ich bis dahin nie so recht beachtet hatte: stählerne Profilschienen, und die Oberfläche von ausnehmend scheußlicher, schwarzer Plastikfolie mit Ledernarbenprägung verkleidet, dazu billige Chromschlösser – gesehen hatte ich das Ding oft, aber neben den segeltuchumkleideten, schweinsledern bezogenen und eichengerahmten gun cases der spanischen Flinten meiner Eltern nahm es sich so übel aus, dass darin eigentlich nur Leere oder übler Schrott sein konnte. Aber weil es halt nun sonst nichts mehr zu tun gab, nahm ich das Ding halt aus dem Regal, um es auf den Werktisch zu heben – und stutze. Der Koffer war voll und wog schwer.
Ich versuchte, die Schlösser zu öffnen, aber sie waren versperrt, und wo der Schlüssel dazu war, das wusste Gott. Vielleicht. In einem Pappkarton unter dem Werktisch fand ich ein ganzes Sammelsurium von Kofferschlüsseln, und das billigste, schlampigst gearbeitete gezahnte Stück Weißblech ließ die Scharnierschlösser aufklappen. Vor mir lag eindeutig ein Flintenpaar, gehüllt in beigen Wollfilz. Ich nahm ein Laufbündel und einen Schaft aus dem Koffer, streifte die Hüllen ab, und hielt die Teile einer bildschöne Seitenschlossflinte in Händen. Schlossbleche und Baskül waren mit feinem Arcanthus-Laub verziert, die Einpassung der Schlösser ins Schaftholz so vorgenommen, dass das Blech nicht in einer planen, hölzernen Rahmung liegt, sondern alles beinah nach „rounded action“ aussieht, die seitlichen Ausläufer des Demibloc der Läufe endlich nicht plan zur Basküle hin abgefeilt, sondern als kleine, ansprechend gravierte und guillochierte Lappen an der Laufwand heraufgezogen. Das Baskül trug den Herstellernahmen „Gambetta“, die Läufe aber waren knapp oberhalb der Lager in geschwungener Schrift mit den Worten „Wirnhier Jagd“ versehen. Gambetta sagte mir damals noch gar nichts, wer der Conny Wirnhier war, das wusste ich genau: Olympiasieger von 1972 auf der Schießanlage Hochbrück, Erfinder der nachmalig ebenfalls olympischen Sportart des Doppeltrap, Ausnahmsschütze und Schießlehrer meines Vaters. Was ich in Händen hielt, das war sein erstes auf ihn gebautes Flintenpaar.
Ich setzte die Flinte zusammen, wog sie in Händen, hob sie, schlug sie endlich an – und sie schien zu liegen. Das war natürlich nun ein völlig Ding der Unmöglichkeit: mein Vater unterragt mich um Haupteslänge, hat dafür einen deutlich breiteren Brustkasten, ist aber zuletzt und zuerst ein Rechtsschütze – und ich bin ein Linker.
Dennoch lag die Schiene sauber zentriert vor meinem Auge. Ich wiederholte den Anschlag, nun auf ein Ziel: wieder war ich sauber drauf. Ein dritter Versuch, diesmal mit geschlossenen Augen, und als ich sie öffnete, da dass das silberne Korn exakt im Scheitel des Schienentrapezes und just an der Unterkante eben des Lichtschalters, den ich fixiert hatte, ehe ich die Augen schloss und die Flinte anschlug. Sie lag.
Noch am selben Abend beschwatzte ich meinen Vater unter etwelchen Whiskys, nächsten Tags auf den nahegelegenen Schießstand seines Schwippschwagers zu fahren, um mal „ALLE im Haus vorhandenen Flinten“ zu beschießen. Ein Paar Garbi, ein Paar Ugartechea, eine Browning-Mitrailleuse, die 16er Kaletztky meines Bruders, meine eigene 16er von Miguel Ugarteburu – und die beiden Wirnhier- Gambettas. Sie hielten auf die anstreichenden Tauben vom hohen Turm das, was sie mir abends in der Gewehrkammer am Lichtschalter versprochen hatten. Und zu Weihnachten, dem fünfundzwanzigsten meines Lebens, da wurden sie mein.
Sie haben mich seitdem auf vielen Jagden begleitet, ihnen fielen bis heute an die 2000 Stück Niederwild – aber bis es soweit war, dass ich verlässlich mit ihnen traf, brauchte es noch einiges an Übung. Und die nahm ich mir zu diesem speziellen Weihnachten gezielt vor. Denn bei einer Buschierjagd in den letzten Dezembertagen dieses Jahres merkte ich, dass ich mit dem neuen Zauberzeug zwar treffen, aber auch ganz gehörig vorbeischießen konnte. Genau dieses Vorbeischießen wollte ich mir – so gut es ging – abgewöhnen.
Ich war damals beruflich ins Badische übersiedelt und suchte nach einem guten Wuftaubenstand. Mit etwas Recherche fand ich heraus, dass die französische Armee für ihre Offiziere und Mannschaften in einem Vorort von Strassburg einen Parcours de chasse unterhielt, genauer gesagt in La Wantzenau – jenem Dörflein, dass den Freunden guter Ganslebern nur allzu bekannt ist.
Dort reiste ich also eines schönen Tages an. Ich sprach damals kaum ein Wort französisch, denn meine Schulzeit war geprägt von Graecum und Latinum, und die junge Dame, die mich die Sprache lehren sollte (und die heute eine liebe, gute und nicht fortzudenkende Freundin geworden ist, Gott und seiner Gnade gedankt), die war noch nicht in mein Leben getreten. Ich radebrach mir also die Erlaubnis zum Mitschießen, lernte ein paar Brocken Französisch und dank eines vom Vater ererbten Dialektohres ein relativ sauberes Elsässisch und fand im „C.T.P.A de La Wantzenau“ endlich Aufnahme und Mitgliedschaft. Auf diesem Stand habe ich während der folgenden zwei Jahre beinahe jeden Mittwochnachmittag und –abend, jeden Samstag und Sonntag verbracht. Das Trainingsprogramm stand fest: fünfzig Tauben Skeet, um beweglich zu werden. Fünfzig Tauben Trap auf 15 Meter im Voranschlag, denn diese Disziplin lehrt wie keine andere, wie das Ziel den Schuss bestimmt. Und endlich 100, an manchen Tagen auch 125 Tauben Jagdparcours. Fünftausend Tauben pro Jahr, das war das minimal festgesetzte Ziel. Und an diesen Trainingsplan hielt ich mich ehern, was keine große Überwindung kostete. Denn zum einen macht das Tontaubenschießen größten Spaß, und zum anderen fand ich unter den französischen Schützen beste Kameraden und Freunde, die jederzeit bereit waren, alle möglichen neuen Stände, Winkel und Kombinationen auszuprobieren. Als ich mit der Zeit mittags wie abends gebeten wurde, am gemeinsamen Dejuner oder Diner teilzunehmen, mit zu essen, zu trinken, zu lachen, da war dieser kleine, feine Verein eine Art Heimat geworden. Merci mille fois, me chers ami, s’ isch e zuggrschöni Zit gesin!
Und neben der „zuggrschöni Zit“ kam noch etwas anderes herum dabei: ich traf mit meinen Gambettas verlässlich. Damals war ich Mitglied der Trumauer Jagdgesellschaft geworden, hatte somit Zugang zu einer sehr guten Niederwildjagd, und dank es Trainings in La Wantzenau stieg mein Patronen-Trefferverhältnis nur an schlechten Tagen über die Grenze von zwei zu eins. Und auf diesen Jagden habe ich begriffen, was die Faszination des rauen Schusses aus glatten Läufen ausmacht. Jagt man mit der Büchse auf der Pürsch, dann ist alles Sinnen dem Herankommen ans Wild gewidmet, dann will, dann muss man nahtlos in der Natur verschwinden, muss Teil des größeren Ganzen werden um in aller Ruhe, überlegt und durchdacht den blitzartig tötenden Schuss anzubringen. Auf der Flintenjagd – wenn es sich um getriebenes Niederwild handelt – ist das anders: auch hier sind Überlegtheit und Durchdachtheit des Schusses kardinal. Aber: man ist Fremdkörper, man wird es immer sein, und was man an innerer Kraft nicht für das Teil-Werden aufwenden muss, das muss man in die Tötung des Wildes legen. Denn man beschießt nicht ein einzelnes Individuum und geht dann mit der Beute nach Hause, man bejagt eine Vielzahl von Lebewesen, und jedes davon, jeder Fasan, jede Taube, jede Ente, jeder Hase muss mit der gleichen Konzentration bejagt und erlegt werden wie der eine Bock, der eine Hirsch, die eine Sau am Ansitz. Gelingt das, schafft man es, das Gelernte und Geübte vorbei an allen Widrigkeiten von Wind, Wetter, Sorgen, anderen Gedanken, Problemen, an allen Hindernissen vorbei in den tötenden Schuss umzusetzen, dann ist es Jagd, dann ist es sauberes Waidwerk. Dann ist es Freude.
Versagt man auf der Pürsch, versagt man beim Einzelschuss auf der Büchse, dann kann es die falsche Optik, der zu gewagte Schuss, das schlechte Licht, das Jagdfieber, dann kann es eine Vielzahl von Gründen gewesen sein, die für den Fehler sorgten.
Bei der Flintenjagd bleibt der Fehler selten allein, und es gibt keine Vielzahl von Gründen aus äußeren und innern Umständen, es bleibt letztlich nur das Versagen des ganzen Jägers, des jagenden Menschen in seiner Gesamtheit. Gelingt es aber, trifft man, dann ist es in der Umkehr die Leistung und - auch das will gesehen und gesagt sein – der Triumph des ganzen Jägers, des jagenden Menschen in seiner Gesamtheit.
Ich habe solche Tage erleben dürfen. Tage großer Niederwildstrecken, an denen kaum ein Schuss oder nur selten einer fehl ging, an denen ich mir mein Fenster am Himmel suchte und es bediente. Solche auch, an denen ich, wenn ich dieses Fenster in allen Winkeln kannte, es verließ und Schüsse weit nach hinten tat, und das von den Nachbarn vierläufig gefehlte, hoch und pfeilschnell fliegende Winterhuhn fiel im Hagel. Tage mit hohen zweistelligen Strecken am Stand, und nach dem Trieb merkte ich, wie die Beine schwankten und die Kondition schwand, weil ich bis zur völligen Verausgabung Schuss um Schuss aus beiden Flinten getan hatte. Aber auch auf kleinstreckigen Jagden, deren Wild aber aufgrund des Geländes und des großen Könnens der Berufsjäger turmhoch und Elends weit draußen strich: querreitende Vögel zwischen dem dritten und vierten Nachbarn, von beiden nach vorn beschossen und gefehlt und nimmer angesehen. Dann der lichtschnelle Gedanke: „Wagst Du’s?“, und hoch ging die Flinte, schwang weit, anhaltslos weit, kontaktlos weit nach vorne, brach der Schuss, fiel das Ziel. So kam der Moment, wo meine Katabasis beginnen musste, mein Fall prädestiniert war, wo ich von mir selber sagte: „Ich bin ein guter Flintenschütze.“
Dieser Moment kam schleichend, und er kam mit meiner Übersiedelung nach England. Zuerst konnte ich – aufgrund der im Vergleich zu Deutschland erheblich strengeren Waffengesetze – meine Gewehre nicht mitnehmen, sondern konnte sie nach einem langwierigen und von schier peinlicher Befragung geprägten Zertifizierungsverfahren erst gut ein Jahr später nachholen. Und dann hatte ich mich endlich glücklich – nicht verliebt, nein, ich liebte glücklich und tu es heute noch und habe dieses Zauberwesen aus der wahrscheinlich größten Gnade heraus, die mein Schöpfer mir geschenkt und zugedacht hat, auch noch heiraten dürfen. Aber das braucht alles seine Zeit: Übersiedeln, Berufswechsel, Hochzeitsvorbereitungen, Hochzeit selbst: Büchse ja, manchmal. Flinte: no way. Glaubt es mir, ich sage es ehrlich: es war kein Opfer, und ich habe noch nicht einmal daran gedacht, dass ich über all das die liebgewonnene Flintenjagd vernachlässigt habe. An das Ans-Flintenschießen-Denken kam ich erst wieder nach der Hochzeit: auf dem Gabentisch, der zu diesem Tag von Freunden und Verwandten in einem Amalthea, Gaia, Eirene und Tyche beschämenden Überreichtum gedeckt wurde, fanden sich auch zwei Handschreiben, die mich ganz besonders, die beste aller denkbaren Ehefrauen aber nur minder freuten: das eine war eine Einladung in die schottischen Borders aus der Hand eines der Trumauer Jagdfreunde, der mich schon viele Jahre zuvor auf den Kleinen Hahn jagdlich beherbergt hatte, das andere aber bat mich in eben jenes Revier in den Cotswolds von Gloucestershire, in dem ich seit etlichen Jahren auf Rehe jagen darf. Beide Einladungen lauteten auf „Pheasants“. Fasane.
In England auf Flugwild geladen werden: gibt es heute irgend etwas, was einem Ritterschlag näher kommt? Unsere Hochzeit hatte im August stattgefunden, und schon im Januar, an zwei aufeinander folgenden Wochenenden waren die Jagdtermine. Den einen davon, den in den schottischen Borders, sagte ich umgehend und dankend zu, meine Freunde in Gloucestershire aber, Georges und Tristan, bat ich um Aufschub. Das hat einen ganz einfachen Grund: ich kannte das Revier zu diesem Zeitpunkt schon recht genau, mit all seinen Hanglagen, seinen Tälern und vor allem mit all seinen Trieben. Somit konnte ich mir grob vorstellen, wie die Vögel dort fliegen würden: hoch. Sehr hoch. Denn beide Jagdherren haben sich der Jagd auf „High Birds“ verschrieben, haben solche auf ihrer eigenen Jagd und reisen zudem jeden Herbst und Winter nach Devon, wo es zwei besonders berühmte Jagden auf solche High Birds gibt: Castle Hill und North Molton. Ich wurde einmal als Begleitung dorthin mitgenommen, und habe gesehen, wie hoch Fasane streichen können, wenn sie richtig getrieben werden – und dass diese Vögel absolut tödlich zu treffen sind, wenn man es gelernt hat. Auf den Jagden in Österreich, auf denen ich bis dahin war, gab es zwar durchaus auch hohe Vögel, aber wenn sie hoch waren, dann waren sie bei fast, in seltenen Fällen und vereinzelt bei mehr als 30 Metern Höhe. Sowohl in Devon als auch in Gloucestershire wären das die niedrigen Vögel gewesen.
In den Cotswolds von Gloucestershire, im Rehparadies, gibt es einen Trieb, den ich exemplarisch beschreiben möchte: er heißt Lime Hill. Dieser Lime Hill grenzt das Tal, in dem das Revier liegt, nach Osten hin ab. Es ist ein steiler Hang mit gut 20 Steigungsprozenten. In der oberen Hälfte ist er mit alten Buchen und Fichten bestockt, dann schließt sich nach unten hin ein siebzig Meter breiter, schwächer geneigter Wiesenstreifen an, hinter dem das Gelände wiederum steil in eine Forstplantage abfällt. Die erste Schützenkette steht auf diesem Wiesenstreifen, gut 50 Meter vom Wald entfernt, der fünfzehn Höhenmeter über den Schützen beginnt. Die nächsten Baumwipfel sind somit mehr als 50 Meter vom Schützen entfernt, und die Fasanen werden noch einmal gute 15 Meter über diese Wipfel hinausgetrieben. Man kann sich nun leicht selbst ausrechnen, in welcher Höhe die Fasane die erste Schützenkette überstreichen. Hinter dieser ersten Kette steht aber noch eine weitere, und hier werden vom Jagdherrn die wahren Meister positioniert, denn sie stehen dreißig Meter hinter und abermals gute zehn und mehr Meter tiefer. Hier sind die Fasanen vollends überturmhoch und stürzen mit atemberaubender Fahrt herab. Hier aber fallen sie, einer um den anderen. Für solche Übungen wollte ich gewappnet sein, und ich wusste, dass mein bisheriges Können das nicht hergab. Ich wollte also zuerst auf die Jagd nach Schottland reisen und dann den Sommer über mit einem Schießlehrer den Schuss auf ganz hohe Ziele üben.
Schottland war traumhaft, von Landschaft und vor allem Gastgeber und Gästen her. Imré W., der Jagdherr, hatte zu dieser Jagd neben einigen seiner ortsansässigen vor allem österreichische und deutsche Freunde und Verwandte geladen, und so war schon der erste Abend ein langes, fröhliches und durchaus whiskyseliges Sitzen, Lachen und Ratschen über gemeinsame, vergangene Jagden in Österreich und Ungarn. Am nächsten Tag, als es zur Jagd ging, war ich trotz der vorangegangenen Nacht fit und motiviert. Und das war dann auch schon alles: ich traf mit meinen vertrauten Gambettas kein Scheunentor, geschweige denn einen Fasan. Die Einfachen nicht, und die Schweren schon gleich nicht. Und schlimmer noch: ich wusste einfach nicht, was ich falsch machte. Ganz selten einmal fiel ein beschossener Vogel herunter. Am nächsten Tag wurde es ein klein wenig besser, und ich kam meinem Problem auf die Spur: denn nun fielen etwas mehr Vögel auf meinen Schuss, aber nur ganz bestimmte. Was mich von vorne hoch anstrich, war seines Lebens sicher. Was nach links flog – für mich als Linksschützen eigentlich er einfachste Schuss – überlebte ebenso. Nur steil und hoch nach rechts streichende Vögel fielen sauber. Leider kamen da die wenigsten. Aber ich wusste jetzt, was los war: man wird nicht jünger, und man wird auch nicht beweglicher. Dieser Umstand und die Tatsache, dass ich wegen des Umzugs nach England deutlich weniger Gelegenheit hatte, die Flinte in die hand zu nehmen, diese beiden Faktoren hatten dafür gesorgt, dass ich mit den Gambettas, die noch auf meinen rechtsschießenden Vater geschäftet waren, einfach nicht mehr zurande kam. Nur bei Schüssen auf die rechts hoch streichenden Vögel schoss der Schaft dahin, wo der Schuss sitzen sollte.
Noch vom Flughafen aus rief ich einen englischen Freund an und fragte um Rat. Er gab mir zwei Adressen: die eine gehörte einem Flintenfachmann namens Nigel Teague, berühmt geworden durch seine hervorragenden Chokes, und nebenbei ein hervorragender Schäfter. Er ließ mich meine Gewehre vier, fünf Mal anschlagen, machte sich dabei Notizen und hieß mich dann in vier Wochen wiederkommen. Für diesen Termin steuerte ich dann auch die zweite Adresse an: eine Schießschule, Ladyswood heißt sie, und der Lehrer ist Michael Pinker. In seiner Schule sollte ich meine Flinten in Empfang nehmen und im Beisein von Lehrer und Schäfter Probeschießen. Nigel Teague hatte zum einen die Schäfte auf mein Maß verlängert, sowohl Senkung als auch Pitch entsprechend hingebogen, aber ich sah auf den ersten Blick, dass die Schränkung immer noch nach rechst lief, und nicht nach links, wie ich es erwartet hatte. Das fiel auch Michael Pinker auf, und er fragte sofort nach dem Grund, da ich ja Linksschütze sei und ergo mit nach rechts gebogenen Schäften überhaupt nicht treffen könne. Nigel winkte ab und sagte nur: „Let’s shoot them and talk later. Lasst sie uns probeschießen, reden können wir danach noch.“
Die Flinten lagen wie zu meinen besten Zeiten, und die Tontauben zerplatzten am Himmel zu rotschwarzem Staub. Nigel grinste sowohl Michael Pinker an und empfahl sich mit den Worten: „ Der Mann hat sein leben lang mit rechtsgeschäfteten Waffen im Linksanschlag geschossen. Hätte ich ihm jetzt einen Linksschaft gebaut, hätte er gar nichts mehr getroffen.“ Ich muss noch einmal dazu sagen: Nigel Teague hatte bei Annahme des Auftrages kein einziges Maß genommen. Keine Schiebelehre, kein Zollstock, kein Maßband war im Spiel. Er sah und wusste. Vor allem aber hatte er gesehen, dass ich mir über die Jahre einen völlig unorthodoxen Anschlag erarbeitet hatte: meine Flinten liegen mit dem Schaftrücken nicht satt an der Backe unterm Jochbein, sondern sie liegen am Kiefer und unterhalb des Kiefermuskels an. So habe ich es mir angelernt, und so treffe ich. Michael Pinker, der Schießlehrer, hat dann an meinem Anschlag nur noch ein Detail geändert: er hieß mich die Laufhand, die ich immer weit vor dem Vorderschaft an den Läufen hatte, für Schüsse über Kopf an den Vorderschaft zurücknehmen, weil ich sonst im Schuss steil nach oben die Läufe nach rechts neben das Ziel zog.
Der Rest war dann Übern am Hohen Turm. In Ladyswood fliegen die höchsten Tauben fünfundfünfzig Meter über Grund. Und sie kommen nur an einer Stelle direkt über Kopf, ansonsten fliegen sie halblinks bzw. halbrechts. Michael Pinker hat mich gelehrt, dass solche Ziele, die auf fast 60 Meter beschossen werden, auch mit einer Querflinte sauber zu treffen sind, er lehrte mich, in welchem Winkel ich solche Ziele als Stichtauben, und ab welchem Winkel ich sie als Querreiter zu beschießen hätte, dass ich rechtsstreichenden hohe Zielen kürzer vorschwingen müsste als linksstreichenden. Neben diesem Wissen nahm ich noch zwei weitere, ungleich erfreulichere Dinge aus seiner Schule mit: einen kleinen Springer Spaniel und die Tatsache, dass meine Frau seitdem auch mit Begeisterung Tontauben schießt.
Nach einigen Monaten regelmäßigen Unterrichts fühlte ich mich fit für die Vögel in den Cotswolds und ließ Georges und Tristan das wissen. Die Reaktion war unisono diese: „Wunderbar, wir planen dich für die Tage X und Y ein – aber lass’ das mit der Schießschule. In einem Jahr ist das nicht erlernbar, komm einfach und versuche, die Tage zu genießen!“ Nun habe ich einmal den deutschen Ansatz der Waidgerechtigkeit, und der gebietet mir nur dann auf Wild zu schießen, wenn ich dem auch gewachsen bin, sprich wenn ich weiß, dass ich das Wild töten kann. Ich ging also insgeheim weiter in die Schießschule und reiste im nächsten Januar, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Debakel in den schottischen Borders in die Cotswolds. Wir waren eine Gruppe von sieben Schützen: Die Jagdherren Tristan und Georges, dazu des letzteren Bruder, ein französischer und ein belgischer Herr sowie zu meiner besonderen Freude ein deutsches Ehepaar vom Niederrhein, beides begeisterte und gute Jäger, die ungemein viel für Wild und Jagd sowohl in Deutschland als auch in Österreich getan haben und tun. Mit beiden ist meine Familie seit langer Zeit in Freundschaft verbunden, mein Vater hatte schon als junger Mann oft in den wildreichen Revieren am Niederrhein gejagt, und ich selbst hatte ein paar Jahre später ebenfalls das große Vergnügen, für einige Tage dort jagen zu dürfen. Nirgendwo in Deutschland habe ich so gepflegte Reviere in einer völlig zersiedelten Landschaft gesehen, und wer mir heute, gegen Ende des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert in Deutschland ein Revier weiß, in dem man auf einem schmalen Wiesenstreifen innert einer dreiviertel Stunde sechzehn Hasen zählt und etliche Fasanen mehr, dazu Rebhühner in echten Ketten, und ums Eck sitzen an vierzig oder sechzig Gänse auf der Stoppel, der sage es mir.
Zurück aber in die Cotswolds: es war die letzte Jagd dieses Jahres, und entsprechend ließ Tristan uns wissen, dass wir keine übermäßig großen Strecken zu gewärtigen hätten, aber es seien schon noch ein paar Ecken da, in denen der ein oder andere Vogel stecken möge. Danach das übliche Losziehen der Standnummern, deren gerade Zahl jeden Trieb die Schützenkette eins heraufsteigt und die ungeraden eins herab. Und dann nahm mich Georges zur Seite und stellte mir meinen Lader vor. Jim begrüßte mich freundlich, fast wie einen alten Bekannten, und dank meines miserablen Namensgedächtnisses musste ich eine Weile lang wühlen, bis es mir klar wurde: in meinem ersten Jahr auf Rehe in England hatten Georges und Tristan mich mit in eine nahegelegen Shooting School genommen, weil sie sich auf die in Kürze aufgehenden Grouse warmschießen wollten. Der Lehrer, unter dessen Ägide auch ich damals einige Schuss getan hatte, das war kein anderer als eben dieser mein Lader Jim. Ein Schießlehrer auf dem Stand, das gibt Ruhe und Sicherheit, und als Jim mir dann auf dem Weg zum ersten Stand auch noch sagte: „Ich habe schon mit Michael Pinker gesprochen, ich weiß Bescheid!“ – ich fühlte mich sicher.
Wer je zum ersten Mal auf einer berühmt guten und schwer zu schießenden Jagd seinen Stand zum ersten Treiben bezogen hat, der wird dieses Gefühl kennen: eine Mischung aus Erwartung, eine hohe und mit Kraft im Zaum zu haltende Motiviertheit und das gepaart mit großem Respekt und letztlich Versagensangst. Da tut es wohl, einen erfahrenen Lehrer an der Seite zu haben: „Nur Ruhe, der Trieb hat gerade erst begonnen. Ich gehe nun seit zwanzig Jahren hier als Lader mit und weiß daher: die ersten Vögel werden unseren Stand in fünfzehn Minuten anstreichen. Bei diesem Licht, diesem Wind und diesem Wetter sind sie zuerst von rechts zu erwarten, gegen Ende werden dann noch ein paar weite Querreiter nach links hinaus kommen, da wir den letzten Stand in der Kette haben. Zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig Fasanen werden uns kommen. Bitte richten Sie sich zuerst auf diese große Eiche im Gegenhang aus, dort werden die ersten Vögel, die für uns beschießbar sind, herausstreichen.“ Ich hätte meine Uhr nach der Präzision dieser Angaben stellen können!
Aber weiß Gott! – diese Vögel waren ein ander Ding als ich es jemals gesehen hatte. Hoch, schnell, weit – und das war noch einer der einfacheren, der Aufwärmtriebe. Ich hatte zu arbeiten, und die ersten Schüsse gingen meilenweit fehl, weil ich zu hastig, zu aufgeregt schoss. Als ich den dritten oder vierten Vogel vorbeigeschossen hatte und mich zu Jim umwandte, ihm meine leere Flinte im Tausch gegen deren geladene Schwester zu reichen, da kam kein Gewehr, sondern der Satz: „Sie bekommen die Waffe erst, wenn sie drei Vögel haben vorbeistreichen lassen und wieder ruhig geworden sind!“ Es half. Der nächste Vogel fiel, ein Fehler, danach eine Doublette gar. Und als dann, als letzter Vogel des Triebes eine Henne unbeschadet vierer Schüsse hoch zwischen meinen Nachbarn durchstrich, als sie dann weit hinter der Kette nach links abdrehte und auf einen gezielten, langsam und ruhig weit nach vorne gezogenen Schuss aus meiner Flinte fiel, als ich diese schon gebrochen hatte und die Patrone aus dem Lager sprang – ich weiß mir wenig Schöneres.
Der nächste Trieb sah mich am selben Stand, denn hatte man zuerst einen steilen Hang etliche sechzig Schritt vor uns getrieben, wurden jetzt die Vögel aus einem Wäldchen, das vierzig Meter hinter uns lag, gedrückt. Meinen nächsten Nachbarn, den erwähnten Herrn und Freund vom Niederrhein, dessen Stand in einer Senke lag, sah ich hier einige prachtvoll hohe Vögel so sauber schießen, dass der schwache Anflug auf meinem Stand alles andere als ins Gewicht fiel. Eine große Jagdfreude wurde mir aber dennoch: mitten in einem größeren Bukett Fasanen, das sich schon weit vor mir nach links und rechts teilte, huschgaukelte ein kleiner, brauner Schatten, wich meinem ersten Schuss nach vorne aus, fiel aber im weichen, weiten Bogen auf die nachgesandte Ladung des zweiten Laufes, und als der Trieb vorbei war, hob ich von der moosüberwucherten Krone einer halbverfallenen Kalksteinmauer Scolopax rusticola auf, den ersten und bis heute einzigen Schnepf meines Lebens.
Für den Nachmittag hatte der Jagdherr zwei besondere Triebe, zwei echte Gustostückerl vorgesehen. Der erste fand in einem breiten Tal statt, über das die Fasanen ein große Strecke zu streichen hatten: vom flushing point bis zur Landung gute drei bis vierhundert Meter über den freien Himmel. In diesem Trieb traf ich wenig bis gar nichts, pudelte und stocherte herum, fand keinen Kontakt zum Ziel, war’s aber deswegen nicht weiter böse, weil ich sowohl zur Linken als auch zur Rechten zwei gute Schützen stehen hatte, denen zuzusehen eine rechte Freude war: ohne Hast und ohne Hektik, fast pomadig und langsam schießend, aber mit großer Präzision und Sicherheit.
Der letzte Tagestrieb sollte dann der schwierigste werden: Eric’s Drive genannt, nach dem verstorbenen Vater des Jagdherrn, der das Gut in den 50er Jahren gekauft und in weiten Teilen zu dem gemacht hatte, was es heute ist. Eric’s findet in einem kleinen Wald statt, der eintausend Meter lang ist, aber seiner Breite nach auf fünfhundert Meter getrieben wird. Diesen Wald durchzieht ein gut sechzig Meter tief eingeschnittener Graben, in dem die Schützen stehen. Ich kam als drittletzter Schütze zu stehen, ganz unten stand der Jagdherr selbst, und zwischen ihm und mir der französische Herr. Ich habe zu Beginn des Treibens ein Photo von ihm gemacht: da steht ein Mensch, die Flinte über der Schulter und auf seinen Zügen ein beinahe verklärtes Lächeln in Erwartung dessen, wovon er genau wusste, wie es kommen würde.
Die Vögel werden in großer Höhe über diesen Graben hinweg getrieben, und dazu herrschten oben auf der Höhe Windgeschwindigkeiten beinahe in Sturmstärke. Die Fasanen kamen so, dass man meinen wollte, sie flögen grade aus und ihrem Stingel nach. In Wirklichkeit aber wehten sie seitwärts dahin. Ich brauchte eine ganze Anzahl von Patronen um dahinter zu kommen, und wirklich fielen gegen Ende des Treibens zwei oder drei dieser – um es mit einem britischen Jagdschriftsteller zu sagen – „soaring archangels“ weit hinter mir und außerhalb des Waldes auf den Acker.
Am nächsten Tag ging es mit dem Schießen noch besser: ich fand den Rhythmus und dank meines ladenden Schießlehrers Jim die Ruhe, um von Anfang an für meine Verhältnisse gut zu schießen. Nur als der Trieb an Lime Hill stattfand, da hob ich die Flinte nur ein oder zwei Mal und merkte dann schnell, dass diese Vögel schlicht außerhalb meiner Reichweite waren. Aber das Zusehen allein machte Freude genug: stillheimlich grinsende Schadenfreude, wenn andere statt meiner Löcher in die Natur stanzten, was hauptsächlich in der ersten Schützenlinie geschah, bewundernde Freude, wenn die Vögel die zweite, erheblich tiefer stehende Linie überstrichen und dort klein zusammenpackten und aus großer Höhe in die dichte Kultur fielen. Was aber beinah noch schöner war, das war den weit unterhalb aufgestellten Hundeführern bei der Arbeit zuzusehen. Sie standen da, links und rechts neben sich bis zu sechs Springer Spaniel aufgereiht, die mit bebender Konzentration auf die fallenden oder ausstreichenden Vögel starrten. War ein kranker Vogel in der Luft, wurde einer der Hunde per Fingerzeig losgeschickt. Der Hund lief dann unter dem kranken Wild einher, den Fasan nie aus dem Auge lassend. Und ging der Vogel endlich zu Boden, dann war in vier von fünf Fällen der Hund schon darüber und hatte ihn aufgenommen. Nur manchmal bedurfte es leichter Richtungskorrekturen durch den Hundeführer – die sämtliche nur durch Handzeichen gegeben wurden – damit der Hund das Wild fand. Darauf ging es wieselflink und unablässig wedelnd zurück zum Führer, dem wurde der Vogel vor die Füße gespuckt, und das Hundl nahm wieder seinen Platz in der Reihe ein.
Ganz selten einmal bin ich nach dem letzten Trieb einer Jagd so glücklich, so rundum zufrieden und froh gewesen wie nach diesen beiden Tagen. Und dass ich auf diese weiß Gott schwer zu treffenden Ziele exakt mein Siebtel zur Strecke beigetragen habe, das hat dazu grade noch geholfen. Denn auch wenn es immer wieder heißt: „Es geht ja nicht um die Einzel-, sondern eher um die Gesamtstrecke, wenn es überhaupt um Strecken geht. Das Wichtigste ist doch, dass man gemeinsam einen schönen tag hatte.“, ich kann das für mich nicht unterschreiben. Denn gerade beim Neiderwild geht es sehr wohl um die Strecke, denn der Jagdherr unternimmt die gewaltige Anstrengung der Ausrichtung einer Jagd inkludierend die dazu gehörige Hege, Rekrutierung von Treiberwehr und Hundeführern, Organisation von Fahrzeugen, Unterkunft, Verpflegung etc. bestimmt nicht nur dafür, dass eine Gruppe seiner Freunde unbeholfen über die Felder stolpert, um dann Löcher in die Luft zu schießen. Nein, er will sein Wild erlegt sehen, er will Strecke sehen. Und daran will ich meinen gerechten Anteil nicht haben, sondern geleistet haben. Das bin ich dem Jagdherrn schuldig.