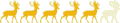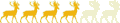- Registriert
- 21 Jul 2006
- Beiträge
- 570
It's storytime again. Bin ja auch lange etwas still geblieben hier drin.
WH
Stets der Eure.
„Heimatböcke“
Ich glaube, dass ich meinem Hergott eher dankbar sein darf, dass er mich da hin hat kommen lassen, wo ich aufgewachsen bin: ins Allgäu. Wohne ich auch schon lange nicht mehr dort, lebe ich da und werde ich da wohl immer leben. Auf den Postkarten sieht das Land recht idyllisch aus, mit seinem braunen Kühen und den Löwenzahnwiesen, aber hat man es erlebt, dann ist das Land so herb wie die Leute dort, so herb wie die Sprache. Sie hat nicht den Charme des Bayrischen oder die Biederkeit des Schwäbischen, aber dafür ist und kommt sie grad raus. Das ist mir alle Mal lieber.
Dieses Land, in dem ich als Büble gelebt habe und als junger Mann, dieses Land war nicht die erste Stätte meiner jagdlichen Sozialisation. Das war das Weinviertel, wie an anderer Stelle schon erwähnt wurde. Aber es war das Land, in dem ich gelernt habe, was Jagd heißt.
Anfangs war es etwas, das sich in Gegenständen manifestierte: Geweihe im Elternhaus, Hüte auf der Kommode neben der Haustür, Ferngläser, Patronenhülsen.
Später dann war Jagd das, was die Eltern taten. Und in diesem Tun war schon für mich als Kind spürbar, dass „Jagd“ etwas unerhört wichtiges, fast heiliges sein musste. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist so ganz untrennbar mit der Jagd verbunden, und zwar mit der Beizjagd.
Meine beiden Eltern flogen mehrere Beizvögel. Einige der Charaktere kenne ich nur aus aus Erzählungen, wie Taps und Ali, oder Dina, das Sperberweib meiner Mutter.
Andere aber aus eigenem Erleben: Freya, das Wanderfalkenweib beispielsweise, das im Falkenhaus wohnte. Dieses Falkenhaus stand an einer hohen Fichtenhecke im Westen des Elternhauses, und dieser Ort zog mich magisch an. Will sagen: ich zog meine Kinderschwester dorthin, mit aller Kraft, die meine Stampfbeine hergaben. Dann stand ich mit respektvollem Abstand vor dem Gitter, sah den großen Vogel auf dem Sprenkel stehen, und seine gelbumrandeten Augen waren helle Lichter im Halbdunkel seines Hauses. Leuchteten. Und brannten.
Mein Vater hatte offenbar bemerkt, wie sehr mich dieses Tier in seinen Bann zog. Eines Tages, als er mit Freya auf der Faust durch den Garten ging, sah er mich in der Tür stehen und winkte mich zu sich heran. Ich bin wohl recht zögerlich auf ihn zugegangen, denn es war das erste Mal, dass dieser große, geheimnisvolle, schöne und gleichzeitig furchterregende Vogel ohne ein trennendes, schützendes Gitter zwischen ihm und mir war. Mein Vater nahm mich an der Hand und führte mich zu einer großen Granitkugel, die als Abschluss eines Rosenbeetes vor dem Haus da lag. Darauf setze er sich, hob mich auf seinen Schoß und stellte Freya vor sich auf den Block. Dann zog er seinen großen Falknerhandschuh über meinen Arm und führte ihn ungemein langsam auf das Tier zu. Ich kann mich an kein Gefühl des Unbehagens in dieser behutsamen Annäherung erinnern, nur an eine große Spannung. Als mein Arm, von Vaters Hand geführt, beinahe die Brust des Vogels berührte, machte Freya einen Schritt und stand auf meiner Faust. Mein Vater hob meine Hand mit Freya langsam hoch, bis sie auf meiner Augenhöhe stand. Dann schob er mit der anderen, freien Hand ein Stück Fleisch zwischen Zeigefinger und Daumen des Handschuhs, und das große Tier beugte sein Haupt herab und nahm die Atzung an. Da war keine Angst, kein Schrecken, da war nur Zauber und Staunen, stilles, atemloses Staunen. Dieser eine Moment hat sich mir in die Seele geprägt, zum einen ob der Größe dieses Erlebens. Zum anderen aber – und das habe ich erst viel später begriffen – weil mein Vater in diesem Moment etwas Besonderes getan hatte: seine Tiere, seine Hunde und Pferde, besonders aber seine Beizvögel waren ihm ganz nah und wichtig. Denn der Greifvogel, vor allem wenn er ein Wildfang ist – wie es alle Greife meines Vaters waren – jagt nicht mit dem Menschen, weil der ihn dazu erzogen und gebogen hat. Er jagt mit ihm, weil er sich dazu entschieden hat. Und an diesem besonderen Tag hat mein Vater seinem Jagdgefährten sein Kind vorgestellt und gezeigt. Wenn ich heute über mein Jagen nachdenke, dann ist dieser Tag so etwas wie meine Initiation gewesen.
Es brauchte noch viele Jahre, bis ich im elterlichen Revier im Allgäu recht ans Jagen kam. Mit „hinaus“ wurde ich früh schon genommen, vor allem von meiner Mutter. Aber ein Gewehr war lange, lange nicht dabei. Mit einem Fernglas, einem Bleistift und den bekannten Skizzenblättern, die, die von links, von vorne und von rechts ein Rehhaupt zeigen, darauf das Geweih einzuzeichnen und nach Alter, Besonderheiten, Ort und Zeit genauest auszufüllen. So ausgestattet wurde ich auf den Hochstand gesetzt, damit ich lernte zu sehen. Erst als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, durfte ich dabei sein, wenn ein Bock erlegt wurde. Es war ein schwacher Gabler von zwei Jahren, und das Geweih liegt heute noch in meinem Kinderzimmer im Elternhaus.
Diese Beobachtungsstunden hatten aber neben dem Sehen lernen noch einen anderen Zweck: ich lernte das Revier kennen nach Namen und Orten. Und wenn dann in Internatsjahren bei Besuch oder Telefonat die Eltern erzählten vom Schwickartsberg, vom Braunkohler, von Schleifertobel und Zengerles Alm, da wusste ich um das „Wo“ – und manchmal sogar um das „Wer“.
Wie ich zu jagen begonnen habe, das steht in anderen Kapiteln dieses Buches zu lesen. Und wie ich meinen ersten Bock im elterlichen Revier jämmerlich angeflickt habe, ebenfalls. Nach diesem Debakel dauerte es eine gewisse Zeit, bis der Rosmer Toni, der Berufsjäger meiner Eltern, mich diese Scharte auswetzen ließ. Ich habe viel und gern mit ihm gejagt, aber es war immer Jagen unter Führung, und ich wollte endlich einmal allein und auf mich gestellt einen Bock schießen.
Als ich nach gut bestandener Matura aus dem Weinviertel wieder ins Allgäu übersiedelte, war ich stolzer Inhaber meines dritten Jahres-Jagdscheins und Führer einer Büchse. Und damit war ich – zumindest nach meinem Dafürhalten – ein relativ vollwertiger Jäger. Damit stieß ich im Elternhaus nicht auf vollste Zustimmung. Als ich meiner Mutter am ersten oder zweiten Tag nach der Heimkehr vorschlug, gemeinsam „hinaus“ zu gehen, stimmte sie sofort zu. Ich adjustierte mich zum Waidwerk und erwartete in voller Montur meine Mutter in der Halle. Als sie ebenso in voller Montur auftrat, sagte sie mit Blick auf meinen Stutzen: „Und was willst Du damit?“ Ich habe auf diese Frage damals nur ein relativ dämliches „Schießen!“ herausgebracht. Was genau die falsche – oder in den erzieherischen Ohren meiner Mutter richtige – Antwort war: „Schießen willst Du? Meinetwegen. Wenn ich es Dir erlaube. Und bevor ich es Dir erlaube, musst Du mir erst einmal beweisen, dass Du einen Bock richtig ansprechen kannst. Wir werden also ab jetzt immer wieder gemeinsam gehen, Du sprichst an und gibst frei oder nicht. Ich schieße alles, was Du mir ansagst. Und hinterher sage ich Dir, ob das in Ordnung war oder nicht. Außerdem will ich dann noch sehen, dass Du aufbrechen, aus der Decke schlagen, zerwirken kannst. Wenn Du das kannst, dann zeigst Du mir, ob Du daraus auch noch etwas Essbares herrichten kannst. Und wenn Du das auch noch kannst, dann lass ich Dich jagen.“
Das wurde ein spannender Sommer. Es gab einige Abschüsse, die nicht in Ordnung waren. Es gab nie ein Donnerwetter, sondern genaue Erklärungen. Es gab den ein oder anderen Abschuss, der richtig war. Und wenn meine Mutter von mir den Erlegerbruch mit einem „Passt!“ annahm, dann waren das ganz große Augenblicke. Mein Vater, der in allen anderen Dingen erheblich strenger mit uns Kindern war als meine Mutter, mein Vater war in jagdlicher Hinsicht sehr viel nachsichtiger. Mehr als einmal quittierte in späteren Jahren der Jagdherr einen Fehlabschuss mit mehreren zugedrückten Augen. Ich weiß nicht, ob es jemals Diskussionen zwischen meinen Eltern gegeben hat über meine jagdliche Ausbildung. Es ist mir auch egal: so sehr mir damals die – von mir als Gängelei perzipierte – Haltung meiner Mutter gestunken hat, so dankbar bin ich heute darum. Wobei es von Beginn der „Ausbildung“ an drei Jahre gedauert hat, bis ich meinen ersten Do-it-yourself-Bock erlegt habe. Und selbst der fiel noch bevor ich von meiner Mutter und – ja, wie sagt man nun: Lehrprinzessin? – freigesprochen worden war.
‚Der Eigene’, So geschehen da, wo es „Im Blitzloch“ geheißen, des Jahres MCMXC Juli, den 12.
Es war in den sengendsten und drückendsten Hundstagen. Ich hatte noch aus der Redaktion den Jager Toni angerufen, um mich mit ihm zur Abendpürsch zu verabreden. Was nun genau der Grund war, das weiß ich heute nicht mehr: war er zu müde oder anderweitig verhindert – egal. Seine Antwort war so oder so ein Stromschlag: „Woisch was, Du hocksch de heit alloi naus. Hocksch de irgendwo na, Sennberg oder so.“ An dem Nachmittag ging in der Redaktion nicht mehr viel, und ich bin mir recht sicher, dass ich mit irgendeiner faulen Ausrede meinen Arbeitsplatz deutlich vor der Zeit verlassen habe. Den Eltern war schnell etwas erzählt von wegen Rosmer und rausgehen, dann war ich im Auto und im Wald. Der Sennberg, den mir der Jager genannt hatte, ist eine kleine Alm, auf der der Wind immer so bläst, dass man sie eigentlich nur wegtechnisch gesehen von hinten her angehen kann. Will sagen: man muss die gesamte Alm auf einem Forstweg umschlagen, um in guten Wind zu kommen. Der besagte Weg führt aber durch die Wände eines der in dieser Endmoränenlandschaft häufigen Tobel, und die Chance, dort etwas zu vertreten sind so hoch wie die Wände steil. So fuhr ich den gesamten Weg bis zum Einstieg in die Almwiesen hinter und stellte mein Auto dort ab.
Man kennt das. Da ist einem ein bestimmter Pirschweg oder Hochsitz zugewiesen, und steht man erst davor, hat man das sichere Gefühl: Heute nicht! Genau so ging es mir an diesem Abend. Ich spekulierte ein wenig in die Wiesen hinein und wusste: heute geht wenn, dann was im Wald. Zudem wehte der Wind an diesem Abend ausgerechnet in die andere Richtung, also ließ ich die Alm hinter mir und wandte mich waldwärts.
Geht man vom Sennberg aus in den Bestand hinein, immer schön brav in der Schicht, dann hat man mit vielleicht siebzig Schritt einen Fichtenhochwald durchmessen und kommt auf ein Schlägle hinaus, das nach Osten hin steil ansteigt. Ein und einen viertel Hektar misst die Fläche, kein Schlag, ein Schlägle eben, genannt das Blitzloch. Die nördliche Hälfte dieser Fläche ist relativ frei, Farnwedel und Graswerk halt, die südliche Hälfte war damals eine schon recht ordentliche Kultur von vielleicht zehn oder fünfzehn Jahren. Exakt an der Grenze zwischen Freifläche und Verjüngung stand eine hohe Kanzel. Eigentlich hatte ich vorgehabt, das Blitzloch hinauf zu pürschen und dann überm Grat in ein paar Freiflächen und Schneisen hineinzupürschen und das ganze im Wurzefauteuil einer alten Buche im Tobel unten ausklingen zu lassen, wo ich einen Wechsel wusste. Wurzelfauteuil, Wechsel, Buchenaltholz – ja, das klingt ganz nach Gagern und genau so war es auch geplant: mein erster eigener, ganz selbst erjagter Bock sollte ebenso geschossen werden wie „Auch einer“, der „Falsche Demetrius“, der „Slahziz“ und wie sie alle geheissen haben mögen im Silioutz, im Tusti Dol, im Brlog. Das mag vermessen sein, und es ist mir nebstbei nie gelungen einen Bock nach Gagern’scher Manier zu. Aber man darf ja träumen.
Für diesen Abend aber war dem Träumen ein schwerlastendes Hindnernis entgegengesetzt: die drückende Hitze hatte dem Himmel die Farbe geschmolzenen Bleis übergezogen, und die Wolkendecke kam immer tiefer herab. Kein Wetter für die steilwandigen Nagelfluh-Tobel des Reviers. Ich strich Gagern zugunsten von Frevert und setzte mich auf die Kanzel am Blitzloch. Wobei ich Gagern freilich zur Ansitzlektüre im Schnerfer hatte. Zum Lesen kam ich aber an diesem Abend nicht: Der Himmel hatte sich vom lastenden Bleigrau zu dem Violett gewandelt, wie es der Pfarrer in der Karwoche als Messgewand trägt, und von dahin zum karfreitäglichen Schwarz. Wind war aufgekommen, Brise zuerst, dann stärker werdend, bis an den Sturm. Ich saß auf meiner Kanzel und gab mich dem Schauspiel hin: hoch oben über den Wolken zuckte es schon loh, bald war das ganze Firmament über dem schwarzen Schleier hell erleuchtet, und dann fuhr der erste Strahl gleissend herab. Vier oder fünf Lichtäste waren in den Wolken zusammengetroffen und sausten im lichten Keil weit hinaus in die Täler. Stumm zählte ich bis zur Sieben, dann kam der Schlag dazu. Kaum verhallt, warf der Himmel den nächsten Blitz hinterdrein und so ging es Strahl um Krach und Schlag um Strahl. Aufs Mitzählen hatte ich längst vergessen, ich sah auch so, dass das Wetter schnurgerad auf mich zuhielt. Kurz kam mir noch der Gedanke, dass Nomen des Ortes auch Omen sein könnte, und das ein Blitzloch beim Gewitter nicht ganz so sicher sei wie Abrahams Schoß. Doch bevor ich diesem Gedanken recht Form und Folge geben hätte können, wurde es still, kam die Stille, die das Große Fechten am Himmel kündet. Und in dieser Stille sah ich die Jagd.
Überall da, wo man es in ganz früher Zeit „Germanisch“ hieß, geht die Sage von den Unsteten und Unwegsamen, die mit Odin reiten und reiten und immer so fort, ohne Anhalt und Ziel, immerwährend in Folge von Lust und Fluch. Wird ihnen auch Beute, so wird nie Erfüllung daraus, und halten sie Rast, so ruhen sie nimmer.
Odin, Wotan, Muotis – viele Namen hat der Einäugige, der sie leitet. Muetes Heer heißt man die Jagd bei uns im Gäu, und wirklich und wahrlich ritten die Ruhlosen vor mir über die Schneid: falb und fahl die Rösser, geduckt darauf die Schemen. In fliegende Fetzen gehüllt nahmen sie den Grat als wär’s eine Hecke oder ein Graben. Hugin flog vorneweg und Munin, hinterdrein deren Brüder und Schwestern, und hoch in den Lüften war ein Schreien zu hören, ein Rufen und Tönen von Hörnern. Einige wenige waren es erst, Spitze der Schar, dann mehr und mehr in breiter Front kamen die Nebelfetzen über den Berg geritten, glitten hinter mir in die Finsternis und ins Tal hinaus, weiter nach Osten hin.
An diesem Abend im Blitzloch habe ich aber nicht nur gelernt, dass die Sage von Muetes’ Heer wilder Jagd ihren wahren Kern hat. Denn als Fahrt vorüber war und das Gewitter noch einmal mit verstärkter Kraft losbrach, sich in Minuten verbrauchte und verflog, als dann, nach starkem und kühlendem Schauer die Wolken aufrissen und die Sonne immer noch kraftvoll genug war um wärmende Strahlen in den triefenden Wald zu werfen, da stand in jedem Tobel, in jeder Scharte, in jeder Falte ein altes Weib und rührte im Kessel Fledermaushaar, Hundszahn, Otternzunge, Stacheligel, Eidechspfot’ und Eulenflügel zusammen, dass hoch stieg der Dampf säulenweis’ in den Abendhimmel hinein. Und war es auch im Jahre MCMXC: ich bin sicher, dass unten in den Höfen und Häusern manch einer in den Berg schaute und still das Kreuz schlug, weil wieder die Wetterhexen waren am Werk, am unheiligen.
Ich sah und schaute und staunte, weil sich die Sagenwelt meiner Kindheit, die Schauergeschichten am Kinderbett, die Schlaf raubten und Schwertraum brachten, die aber dennoch immer und immer wieder erbettelt wurden von den Schwestern, weil dieses Geheimnis sich mir gezeigt hatte. Und haben Geheimnis und Heimat die selbe Wortmutter im Heim, und war mir Heimat dank dem Geheimnis, dessen teilhaftig ich nun war werter und wärmer. Und in all dieser romantischen Schwärmerei glotzte mich schräg aus dem Jungwuchs ein Bock an.
Ich hatte damals mit den ersten Gehversuchen in Sachen Photographie begonnen und beschlossen das zu werden, was ich bis heute nicht geworden bin: ein großer Wildphotograph. Unter kompletter Überziehung meines nur von schmalem Volontärsalär gespeisten Kontto hatte ich mir aus zweiter Hand eine Nikon-Box gekauft, und aus brüderlichem – und zugegebenermaßen unwissenden – Erbe hatte ich ein 400mm-Novoflex-Teleobjektiv entnommen, ein elendslanges, unhandliches Ding. Diese beiden Bestandteile meiner Ausrüstung schraubte ich in der Kanzel zusammen und legte optisch auf den Bock an. Der hatte inzwischen seine Entlaubungsaufgabe am Brombeerhag wieder aufgenommen, und mit guter Auflage und bei anständigem Licht verschoss ich einen ganzen Film auf ihn. Auf den Bildern war nachmalig nicht viel mehr zu sehen als halt ein Bock im Wald.
Als die Kamera endlich voll war, kam mir dann doch noch die Idee, den Bock vielleicht auch einmal mit Glas und Spektiv genauer anzusehen: mein alterGucker wies etwas, das nicht wesentlich über die Lauscher hinausging, aber unten recht massiv war. Das Spektiv gab da schon mehr her: völlig blankgefegte Stangen, keine Perlung, nur noch Riefen, die vom Augend hinab direkt in den Schädel des Bockes zu laufen schienen, denn der breitwulstende Kranz der Rosen waren einem steil abfallenden Dachtrauf gewichen. Ein graues, verwaschenes Gesicht dazu, die Stangen tief in den Schädel gedrückt: das war das letzte, das wichtigste Zeichen des alten Bockes, so hatte es mir der Rosmer Toni bei unzähligen Pürschen und Ansitzen eingetrichtert.
Der Schuss war keine hohe Kunst, die Auflage für Lauf und Ellbogen sicher und fest. Das Absehen stand hinterm Blatt, und im Knall machte der Bock eine hohe Flucht, ein paar junge Fichten wackelten noch, dann war Ruhe. Im Wald. Bei mir nicht. Meine Hände zitterten nicht, sie wackelten nicht, sie oszillierten. An ein Nachrepetieren war nicht zu denken, an eine beruhigende Zigarette ebenso wenig. Den Schuss hatte der Bock, das wusste ich, und einen guten. Passend war er auch, da war ich mir sicher. Die mütterliche Rüge, die ich unzweifelhaft zu erwarten hatte weil ich ohne vorherige Erlaubnis seitens der Jagdherrschaft allein und ungeführt einen Bock geschossen hatte, diese Rüge würde erträglich ausfallen. Aber ich hatte allein, ohne Führung, ungestützt und ungeschützt vor allen Fehlern einen Bock geschossen. Das reicht für Tremor und Delirium.
Irgendwann ist auch die größte Adrenalindosis verbrannt und verbraucht. Als ich wieder relative Kontrolle über meine Extremitäten hatte, stieg ich von der Kanzel herunter, repetierte eine neue Kugel ins Lager meines Stutzens und ging zum Anschuss. Rotblasig und hell leuchtete der Lungenschweiß vom Brombeerlaub. Der Bock lag. Aber nicht am Ort.
Mit einem Fünferl mehr Erfahrung – Pardon – mit einem Fünferl weniger Gier und Hitze hätte jeder andere gewartet, bis der Bock aus den Brombeeren heraus auf die Freifläche gezogen wäre und hätte ihn dort geschossen. Nur ich halt nicht, und so musste ich hundlos den Bock im dichtesten Gewachs nachsuchen. Ich spähspekulierte mir die Augen aus dem Schädel: mehr als den Anschussschweiß konnte ich nicht finden. So ging ich halt irgendwann auf alle Viere nieder, und wie ein Hund habe ich mit tiefer Nase meinen Bock gesucht, bin der Fährte gefolgt unter den Bormbeeren durch, um eine jungstachlige Fichte herum hangab, bis ich irgendwann etwas schmales, behaartes unter meinen Händen fühlte: der Hinterlauf.
Ob es Viertel- oder ganze Stunden später waren, dass ich den alten Gabler oben auf die Schneid gezogen hatte, weiß ich nicht mehr. Und wie spät es war, als ich beim Toni damit ankam, auch nicht. Der haute mir erst einmal ein Waidmanns Heil auf die Schultern zum ersten eigenen Bock, dass mir das Schlüsselbein knirschte. Dann kippte er mir einen Schnaps in den Schädel, weil ich doch recht bleich aussah. Und anschliessend kratzte er sich am Kopf und sagte: „Hilft alles nix, den miesse mr em Fürscht und dr Fürschtin zoige. I komm mit!“
Der Bock lag sauber gestreckt auf dem Kies vor der Haustür, als ich den messingnen Klopfer gegen das grünlackierte Holz fallen ließ. Meine Mutter machte auf, sah den Bock, sah meinen Bruch am Hut, sah meinen etwas betretenen Gesichtsausdruck. „Du allein?“, mehr sagte und fragte sie nicht. Wortlos ging sie zu Wild, nahm den Bock in genauen Augenschein, und nach einer Ewigkeit kam das Wort, das mir heute noch mehr gilt als manches Waidmannsheil: „Passt!“
Mein Vater, der sich das Ganze mit nur schwer verhaltenem Grinsen in der Haustür angesehen hatte, tat einen besonders guten und recht alten Rotwein heraus. Die Leber des Bockes musste ich freilich allein mit Apfelscheiben und Zwiebelringen braten. Wir haben sie auf den Stufen der Haustür sitzend vor dem gestreckten Bock verzehrt. Ich schmecke sie heute noch.
Der Begriff „Heimat“ ist arg strapaziert, und auf die Frage, was er eigentlich bedeutet, gebe ich zu allererst eine Antwort: das elterliche Revier. Dann erst kommen Elternhaus, Freunde, Spache, Land. Sie stehen nur um ein Weniges zurück hinter dem Wald, den Almen und Wiesen. Aber wann immer ich Heimweh hatte, dann zuerst nach der Adelegg. Vor allem meine Mutter hat sie mich gelehrt auf langen Gängen, besonders in der Blattzeit. Am Morgen setzten mein Vater oder der Berufsjäger uns irgendwo im Revier ab, und für den Abend war eine weitere Stelle besprochen, wo wir wieder aufgeklaubt würden. Dazwischen lag ein Tag im Wald, abseits der Forststraßen, auf Pürschsteigen in den Tobeln, auf den Almen Herrenberg, Zengerles und Sennberg, in Hansmartins Wäldele, am Stinnes, am Hochkopf und in hunderttausend anderen Ecken und Winkeln, die alle ihren Namen und ihr eigenes Wesen hatten: da gab es Tobel, in denen auch Sommers noch Schnee lag, steile Leiten, raume Hölzer. Da eine Quelle, dort ein Brunnen und dazu ein Vesper aus der Tasche, und an hohen Tagen ein Besuch beim Bauern auf ein Glas Milch und ein Butterbrot. Die Gänge waren manchmal zäh, vor allem für meine Mutter, die ein irgendwann müdgelaufenes und dementsprechend brummeliges Kind hinter sich herschleifen musste. Aber sie wusste dann doch immer einen Fleck, wo frische Walderdbeeren zu brocken waren oder die saftigsten Him- und Brombeeren im sonnigen Schlag standen oder der Waldmeister wächst.
Sie ging vorneweg, ihre – und heute meine – Büchse über der Achsel, einen Bergstecken mit einer Hirschgabel oben drauf in der Hand, der sozusagen ihr Dirigentenstock war. Mit dem zeigte sie mir die Fährten im Waldboden und las sie mir vor, mit dem wies sie mir Wechsel und Fegstellern oder zeigte auf eine Tollkirsche, die voll schwarzer Beeren hing: „Was heißt das?“ - „Weiß ich nicht.“ – „Die Tollkirsche ist nicht verbissen worden, das heißt, dass in diesem Revierteil kein Hochwild mehr steht!“ Mit ihrem Stecken wies sie mich einzuhalten und still zu stehen, wenn vor ihr eine Bewegung war, mit dem Stecken deutete sie vorsichtig nach dem Wild, denn mit der blanken Hand darf man das nicht, weil das Wild die helle Bewegung sofort sieht. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich heute noch auf der Jagd jedem, der mit der Hand nach dem Wild weist, den Arm nach unten drücke und ihn bitte mir anhand besonderer Geländemerkmale zu beschreiben, wo etwas steht: im Gegenhang die einzelne Lärche, links drunter der Baumstumpf, und zehn Meter rechts davon steht der Bock! So findet man das Wild erheblich besser, als wenn man dem Fingerzeig eines Menschen folgt, der ein paar Meter neben einem steht.
Der Bergstecken meiner Mutter hatte aber noch einen anderen Zweck: manchmal, wenn auch selten, aber manchmal geschah es, daß ich ein Stück Wild entdeckte, das meine Mutter nicht bemerkt hatte. Dann musste ich nur den Stecken, den sie immer waagrecht nach hinten in der Hand hielt, anfassen, und augenblicklich stand sie still und lies mich sie einweisen. Das dann waren Momente, in denen ich ungeheuer stolz war.
Als ich selber den Jagdschein hatte und eine Büchse führen durfte, da kamen mir diese Gänge sehr zu Gute, denn ich kannte das Revier recht genau. Trotzdem gab es immer noch ein paar Ecken, an denen ich noch nie gewesen war, und die hat mir der Rosmer Toni alle gezeigt. Als er bei uns anfing, war ich vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Und bis dahin waren die Berufsjäger sehr ernste und respektheischende Männer in Lederhosen und Försterjacke. Der Toni aber war ein junger und gutaussehender blonder Kerl mit blitzblauen und immer lachenden Augen, derentwegen er recht bald landauf landab beim Weibsvolk der „scheene Done“ hieß.
In der Schule lief es damals ganz hundshäutern schlecht bei mir, und ich hatte in einer unvorsichtigen Minute den Eltern vorgemault, dass mich das blöde Abitur sowieso nicht schere, und ich mit Mittlerer Reife ein Handwerk lernen wolle. Mein Vater quittierte das mit den Worten: „Handwerk werd’ ich Dich lehren. Du hast keine Sommerferien, Du gehst für vier Wochen ins Holz und für vier Wochen dem Rosmer zur Hand!“ Was als Abschreckung gedacht war hatte mir soviel Spaß gemacht – und war neben bei auch noch gut entlohnt – dass ich es seitdem Sommerf für Sommer so hielt. Als ich sechzehn wurde, hatte mein Vater im Betrieb rundschreiben lassen, dass der Bertram ab dato nicht mehr zu duzen sei, sondern als Graf Bertram zu siezen. Das passte mir speziell beim Toni und bei den Holzleuten überhaupt nicht. Wie hätte sich das auch angehört: „Graf Bertram, nehmet se mol a Sappie und ziehet se den Fichtawipf do rum!“ Unmöglich. Und so war klar: ich wollte weiter geduzt werden. Als ich dem Herrn Rosmer sagte, kam seine Antwort: „Des isch mir reacht, aber bloß, wenn Du mi au duzesch!“ Von dem Tag an sind wir nicht mehr als angestellter Berufsjäger und Sohn des Jagdherrn „hinaus“ gegangen, sondern als Freund und Freund. Und wir sind viel gegangen!
Telefon: „Done, ganget mr raus heit obend?!“ – „Ha scho, bisch um fümfe do!“ Und dann gings entweder quer durchs Revier oder gemeinsam auf einen Hochstand, der binnen kürzester Zeit vor schlecht verhaltenem Lachen vibrierte: ein blöder Witz gab den anderen, und die heilige Ernsthaftigkeit des teutschen Weydwercks war – wie der Bayer so schön sagt – tschari! Trotzdem hat es häufig genug geklappt bei solchen Gelegenheiten: zweimal sogar mit Doubletten. Das erste Mal saßen wir gemeinsam auf einer offenen Kanzel, die so an ein Waldeck gestellt war, dass man die beiden Teile einer rechtwinkelig verlaufenen Wiese einsehen konnte. Auf meiner Seite trat ein schwacher Jahrling aus, und ich stupfte den Toni an: „Bei mir schtoht en Bock.“ - „Bei mir au.“ – „Ebbes rechtes?“ -„Noi.“ – „Ha, bei mir au it. Ond was mache mer jetzt?“ – „Ha, Du nimmsch Dein Bock, und i nimm dr meinige.“ Es brauchte noch nicht einmal ein verständigendes Auf-Drei-Zählen. Simultan fielen die Schüsse, und zur Rechten sah man wie zur Linken zwei ganze Böcke niedersinken.
Die zweite Doublette mit dem Toni war deutlich aufregender: wir hatten an einem Morgen Ende Mai den flacheren Teil des Revieres abgepürscht und spazierten gemütlich über eine mehrere Hektar große Freifläche mit Wiesen und Weiden. Ellmeney heißt dieser Ort von Alters her und war somit einst die Gemeindeweide oder Allmende der umliegenden Dörfer. Auf einer der Wiesen standen friedlich beieinander zwei Rehe. Das Glas zeigte einen Bock und eine Gaiss. Der Bock war nix Rares: ein älterer Kumpan mit schwachem G’wichtl, ein passender Abschussbock. Und während wir auf ihm herumspekulierten, sah bei der vermeintlichen Gaiss etwas, was man bei einer Gaiss gemeinhin nicht sieht: einen hellen Strahl unter dem Bauch, der nach vorne plätscherte: „Done, gugg amol die Goiss a, die soicht wie en Bock!“ – „Die soicht it blos wie en Bock, die isch en Bock!“ Ein Knöpfler wars, der da neben dem Alten in der Wiese sich erleichterte. „Bertram, woisch was, jetzt nemmsch dr Jährling, dann repetiersch, dann nemmsch dr Alte!“
Ein Zaunpfahl stand kommod zum Anstreichen da, und weit wars auch nicht. Auf den Schuss hin warf des den Jahrling nach hinten, ich repetierte eine neue Kugel in die Kammer und schickte sie dem Alten aufs Blatt, der sich im Schuss auf die Keulen setzte. Ich hatte bereits nachgeladen und war schon wieer mit dem Fadenkreuz auf dem Blatt des alten Bockes, als mich der Toni an der Schulter packte: „Lass dr Alte, der isch glei hi, ond guck bessr noch dem junga Bock!“ Der Knöpfler, den es im Schuss umgeworfen hatte, war inzwischen wieder hoch geworden und flüchtete dem Wald zu. „Zefix, der hat doch Schweiß am Blatt, ich seh’s genau“, rief ich. „It schiesse!“ befahl der Toni und schickte seine stets frei bei Fuß laufende BGS-Hündin Diana mit einem knappen: „Hopp, fang en!“ hinterher. Das Hundle schoss los, tauchte auf der Schweißfährte in den Wald hinein und nach kurzem hörten wir den Standlaut. Noch bevor wir am Bail angelangt waren, hatte Diana den Knöpfler an der Drossel niedergezogen und abgetan. Beide Böcke hatten Schüsse, die sauber im Leben saßen. Aber beim Aufbrechen des Knöpflers eine kaum verletzte Lunge zu Tage kam war klar, dass es sich hier um einen Hohlschuss gehandelt haben musste.
Ich habe umgehend das Geschoss getauscht und seitdem kein solches Erlebnis mehr gehabt.
‚Der Marschierer’, so geschehen am Kaltenbrunn, des Jahres MCMXCII Juni den 27.
Dieser Kaltenbrunn liegt unweit der Ellmeney, und dort hat sich ein anderes schönes Stückle mit dem Toni erreignet. Der Kaltenbrunn ist ein hübsch steiler Hang mit altem Mischwald, den wir ihn von oben her bepürscht haben, denn dort führte eine Forststrasse entlang. Unten lief der Hang in eine große, bürstendicke Fichtenkultur hinein, und darum ließ man dieses untere Ende des Kaltenbrunn in Ruhe. Das war einer der Revierteile, die ich eben noch nicht kannte. Dorthin wollte der Toni an diesem Tag in der Blattzeit, wobei es für echte und richtige Blatterei noch zu früh war: zum einen in kalendarischer Hinsicht, denn vor dem 3. oder 4. August ging bei uns aufs Blatt recht wenig, zum anderen war es aber auch für mich von Rang und Alter her zu früh zum richtigen Blatten. Das war den Gästen der Eltern vorbehalten, die die bestätigten guten Ernteböcke schießen sollten. Ich durfte an den Rändern des Revieres das Pfeiferlspiel üben, und mir war es recht. Da gingen nämlich die alten, heimlichen und verdrahten Kunden, an denen ich damals wie heut mehr Freude hab als an jedem ebenmäßigen Sechser, sei er noch so kapital.
An diesem 27. Juni hatten Toni und ich den ganzen Morgen über unser Glück an mehreren Ecken des Revieres versucht und waren ohne Erfolg und Anblick geblieben. Wir waren bereits auf dem Heimweg in Richtung Huggerhof – so hieß des Jagers Höfle – weil wir wussten, dass in etwa einer Viertelstunde der Metzger des Dorfes die Wienerle aus dem Rauch holen würde, und zwei Pärle solcher rauchwarmer Würste schwebten einem jeden von uns beiden als Frühstück vor. So gondelten wir durch den Friesenhofer Wald dahin, als der Toni plötzlich den Wagen zum stehen brachte, mich kurz ansah und dann sagte: „Doch, des probiere mr jetzt no.“ Ich sah ihn reichlich belämmert und verständnislos an, aber da war er schon zur Autotür draussen, hielt mir den Schlag auf und zog mich am Rockärmel aus dem Jeep. Für eine Weile ging es auf dem Forstweg dahin Richtung Ellmeneyer Wiesen, aber dann bog der Toni in eine völlig verwachsene Gasse eben jener Bürstendickung ein, die den Kaltenbrunn nach unten hin begrenzte.
Das war ein saures Pürschen, wenn man dieses Wort überhaupt für die mehr brechende als schleichende Fortbewegungsart hernehmen will, die die jungen Fichten uns aufnötigten. Und während ich da so durchs Gedachs mich hinter dem Toni herkämpfte, die Unterarme mit Nadeln gespickt, weil ich sie zum Schutz vors Gesicht hielt, da kamen die typischen, philosophischen Gedanken, die immer in solchen Situationen auf der Jagd kommen: Was, bitteschön, mache ich hier eigentlich? Und bis ich da wieder heraussen bin, sind die Wienerle beim Metzger fade, kalte Leichen in der Kühltheke. Böcke gibt’s hier bestimmt auch keine mehr, wenn wir aus der Dickung raus sind, weil wir alles vertrampelt haben werden, was im Umkreis von dritthalb Stunden Wegs auf den Läufen ist. Was also, was soll das hier werden?
Irgendwann hatten wir die Fichtenkultur endgültig durchdrungen und schüttelten uns ersteinmal das Nadelwerk aus Kragen und Ärmeln. Wie wir uns dann umsahen, merkten wir, dass wir an einem ganz heissen Eck gelandet waren: alles, aber auch alles sah hier nach Einstand und Rehbock aus, nach alt und gewitzt. Der Hang stieg steil vor uns an, unter den alten Bäumen wuchs halbhohes Gras, hier und da ein paar Brombeerbuschen, kleine Stauden da, wo das Licht bis zum Boden vordrang. Alles,
was ein Bock braucht, alles gab es hier: Deckung, klare Grenzen, Einstand, Äsung. Wir pürschten uns zentimeterweis den Hang hinauf, alle sonnebeschienenen und damit bewachsenen Platzeln säuberlich meidend, immer schön leise auf der Nadelstreu dahin. Ein paar sachte Schritte, dann stehenbleiben, lugen und lauschen. Bricht irgendwo Astwerk, schimpft die Drossel? Nichts? Leise weiter.
Beim dritten oder vierten Standel, das wir so machten, war es mir, als hätte ich weiter oben im Hang eine Bewegung gesehen: ein schmales, rotes Huschen nur, kann auch ein Sonnenstrahl gewesen sein, weiß nicht, langsam weiter, Schritt vor Schritt gesetzt. Da wieder: wieder ein roter Strich und dahinter ein zweiter, jetzt hören wir auch das Rascheln im Laub, denn weiter oben stehen hohe Buchen. Still stehen, nicht mehr bewegen jetzt. Alle Sinne gespannt, der Atem geht flach, das Herz pocht in den Schläfen. Rings im Reigen geht’s da droben, der Bock treibt die Gaiss, soviel ist klar, aber was für ein Bock? Wir drücken uns seitab weiter in den den Bestand hinein, weg vom Licht, tiefer in den Schatten der Bäume. Aufrechtes Gehen ist schon nicht mehr möglich: die Fichten hier sind noch keine alten Tanten, und die Äste reichen noch tief herunter. Auf allen Vieren schieben wir uns zentimeterweis bergauf, und finden bald den Grund dafür, dass wir nur rote Striche sehen über uns und kein ganzes Reh: ein alter Hohlweg mit steilen Rändern zieht sich schräg durch den ganzen Hang, und genau hinter dieser Kante sind Bock und Gaiss zu Gang. Zwischenzeitlich hören wir sie weit schräg über uns, also richten wir uns kommod an der Böschung ein: der Waldboden ist weich, Moospolster bettet den Lauf des Stutzens sanft und sicher: bequemer kann keine Schießstatt sein. Höher in den Hang hinein pürschen, das hieße in die Buchen und das dürre Laub am Boden kommen, hieße unweigerlich Bock und Gaiss vertreten. So passen wir zu.
Oben im Hang ist das Getrappel und Geflüchte verstummt. Ob die beiden noch über uns im Hang sind? Nichts ist zu hören, kein Amselschlag, kein Finkenruf. Die Sonne heizt auch hier im Wald schon mächtig ein, und langsam keimt der Gedanke auf ans Aufgeben, ans Heimgehen, ans Gutseinlassen. Einmal noch mit dem Glas den Hang durchkämmt, und beide packen wir uns im selben Moment am Arm: weit droben zieht es rot durchs grüne Laub. „Dr Bock“ zischt der Toni aufgeregt. „Was isches für oiner?“ – „Ka i it seah!“
Ich habe das Glas meines Stutzens auf höchste, fünffache Vergrößerung geschraubt, der Sicherungsflügel ist herumgelegt, und mit dem Absehen folge ich der Bewegung oben in den Buchen. Die Läufe sind zu sehen, mal mehr und mal weniger vom Rest, ein oder das andere Mal habe ich sogar das Leben frei, aber das Haupt des Bockes bleibt verborgen im Laub. Endlich verhofft er droben, die Bewegung hinter den Blättern zeigt, dass er das Haupt schüttelt, um die Fliegen zu vertreiben, die jetzt mit zunehmender Hitze lästiger werden. Mit Glück bringen sie uns den Bock näher, denn fünfzig Schritt über uns ist ein großer Fleck, über und über mit Farn bewachsen. Da geht das Wild an heißen Tagen gern hinein, weil der Farn alles Geschmeiss abhält. Aber der Bock denkt nicht daran, er bleibt unverrückbar stehen und wehrt sich gegen die Fliegen, so gut es geht. Und endlich nimmt er das Haupt herunter um zu äsen. Mich druchzuckt es heiß, und den Toni neben mir reisst es, als hätte er einen Stromschlag bekommen: Alt!
Alt, dünnstangig, hoch. Und bis auf Läufe und Stich verdeckt. Jetzt zieht er weiter, immer hinterm Buchenlaub. Wenn er so weitergeht, dann kommt er uns endgültig aus. Ich bleibe mit dem Absehen da, wo ich das Blatt vermute, aber es wird und wird nicht frei. Dafür wird der Toni neben mir aufgeregter und aufgeregter, deutlich kann ich sein Zittern spüren und selbst fällt es mir auch schwer, das Fadenkreuz ruhig zu halten. Ich öffne das rechte Auge, um mehr zu sehen von dem Wechsel, den der Bock eisern hält. Da ist eine Lücke im Laub, drunter sieht man den Hang, da muss es passen! Ich halte mitten hinein, auf die vermutete Höhe des Blattes. Bin sicher aufgelegt und völlig ruhig. Die Lücke wird rot, mit der Kugel auf dem Trägeransatz walgt der Bock herunter zu uns, bleibt im Farn liegen und verschlegelt.
Als hätte uns der Leutnant das Kommando „Sprung auf! Marsch! Marsch!“ gegeben, sind wir beide im gleichen Moment aufgesprungen und im Laufschritt zum Bock hingerannt. Ein Rarer wars, ein ganz Rarer: vier Finger über die Lauscher hinaus wachsen die Stangen aus dicken und schweren Rosen, massiv unten drin und immer dünner werdend nach oben. Links eine Gabel mit tiefer Rückvereckung, rechts ein kaum angedeutetes Augend, sonst nur ein langer, blanker Spieß. Die Stangen aber stehen nicht parallel: die rechte ist etwas hinter die linke versetzt, ein marschierend G’wichtl. Bis heute ist es das einzige solche an meinen Wänden geblieben.
*
Der Toni Rosmer ist ein großer Fuchsspezialist und derer von Malepart gab es auf der Adelegg grad genug. Nun ist es ein reines Rehwildrevier, und so war es nicht unbedingt notwendig, Reineke und Ermelyne scharf zu bejagen. Aber Toni hat trotzdem Winter für Winter eine ganze Menge auserlesen schöner Fuchsbälge auf dem Brett gehabt, denn darauf versteht er sich besonders gut. Bevor er im Dienst meines Vaters seinen Berufsjäger machte, hatte er das Handwerk des Präparators erlernt. Da nimmt es wenig Wunder, dass ein Balg, dessen er sich annimmt, später als feinstes Rauhwerk überm Treppengeländer hängt. Ich selbst aber habe der Fuchsjagerei nie viel abgewinnen können, und das hat mit einem ganz bestimmten Erlebnis zu tun.
Über mehrere Jahre hinweg war ein ungarischer Herr bei uns zu Gast auf Rehböcke, und im Gegenzug lud er meinen Vater jeden Herbst auf hohe Fasane nach Schottland ein. In einem Jahr hatte dieser Herr nun seine Frau mitgebracht, eine überaus nette und sehr elegante französische Dame. Und ich, der ich eigentlich vorhatte mich in irgendeinem Tobel zu verklüften um einen von den Alten und Verdrahten der Wildkammer zuzuführen, ich wurde beauftragt, Madame im Revier herumzufahren zu Zerstreuung und Amusement. Man kann sich vorstellen, dass ich alles, was an guter Erziehung in mir war, aufbieten musste, um mir meinen recht schmalen Willen dazu nicht anmerken zu lassen. Dass ich damals kaum ein zitierfähiges Wort Französisch sprach, kam noch dazu. Aber was soll’s, man ist ein treuer Sohn und tut, wie einem geheißen. Ich bat Madame also in mein flüchtig aufgeräumtes kleines Automobil und fuhr sie Tag für Tag im Revier herum.
Auf einer dieser Fahrten kamen wir an einem späten und recht warmen Nachmittag im späten Juni auf der Höhenstrasse des Reviers an eine Stelle, die Schneebauers Reune heißt. Der Schneebauer ist ein großer Einödhof am Fuße der Adelegg, und seine Reune, also sein Holzeinschlag lag eine gute Wegstunde zu Fuß den Tobel hinauf oben im Revier. Heute ist es nurmehr eine kleine Blöße oben auf dem Grat, über die die Forststrasse hinführt. Und auf ebendieser Strasse fuhren wir dahin. Man kommt aus einem Hochholz einen kleinen Stich herunter auf die Reune, und grade da, wo die Blöße anfängt, saß ein junger Fuchs in der Sonne auf dem Weg. Ich schaltete sofort den Motor ab, damit das Füchsle uns nicht bemerke. Das hatte aber auch die Welt um sich herum völlig vergessen und unterzog sich auf seinem Sonnenplatzl einer gründlichen Toilette, leckte sich die Branten, kratzte sich ausgiebig am Gehör, wandte sich dann pfleglich seiner Lunte zu, schnappte zwischendrin nach einem Schmetterling, der ihm aber nicht recht schmeckte und den er darob wieder ausspieh. Just in dem Moment sprang der Kühlerventilator meines Autos mit vernehmlichem Surren an. Den Fuchs riss es herum und auf die Läufe, so dass er graderwegs zu uns herschaute.
Mein Auto damals war knallrot von Farbe, und da das Wild diesen Ton nur als verschwommenes Grau sieht, nahm der Fuchs uns nicht wahr. Aber das Surren, das interessierte ihn doch sehr, und es war ganz deutlich eine Sache, die man noch nicht kannte, der es mithin auf den Grund zu gehen galt. Tritt vor Tritt schnürte der kleine Kerl auf uns zu, kam immer näher heran, und schließlich stand er so nah vor meinem Wagen, daß er durch die Kühlerhaube verdeckt war. Madame und ich wagten nicht zu atmen, nicht uns zu regen, saßen mit vor Spannung weit aufgerissenen Augen da und warteten, was jetzt geschehen würde. Ich nahm an, dass er das Auto umrunden und sich dann davon begeben würde, also schielte ich aus dem Augenwinkel ins Gras und auf einen Langholzpolder neben der Straße. In just dem Moment machte es „Plonk!“, und der rotzfreche Bengel war richtig auf meine Kühlerhaube gesprungen. Das sonnenwarme Blech unter seinen Branten schien ihm ganz besonders zu behagen, er setzte sich hin, wetzte zwei, dreimal mit dem Hinterteil hin und her, rollte sich dann ein und ratzte behaglich vor sich hin. Keinen halben Meter von uns entfernt hielt der junge Herr seine Siesta, und er war offenbar so fest eingedöst, dass er das atemlos gemurmelte „Que ravissant, que incroyablement ravissant!“ von Madame nicht vernahm. Aber wie es halt so ist: die Jugend döst zwar gern und oft, aber nicht lange. Wie lange der Fuchs auf meiner Kühlerhaube geschlafen haben mag – ich kann es beim besten Willen nicht sagen. In diesem Moment fand Zeit nicht statt.
Nach einer Weile begann sich der Welpe zu regen, blinzelte in die Sonne und erhob sich. Da dämmerte ihm dann, dass vier weit aufgerissene Augen auf ihn starrten. Aber er sprang immer noch nicht ab, sondern wollte nun erst recht wissen, was für komische Tiere das seien, die da saßen und ihn anglotzten. Er kam so nah heran, dass er mit seiner Nasenspitze gegen die Windschutzscheibe stieß, und das verstand er nun vollends nicht: da sitzen zwei komische Viecher, die man ganz genau sehen kann, aber dran kann man nicht, und riechen kann man sie auch nicht. Sehr seltsam!
Noch mehrmals stupste er gegen die Scheibe, dann ward es ihm endlich zu dumm, und mit einem Satz sprang er von der Kühlerhaube auf den Langholzpolder neben der Straße, linste noch einmal zum offenen Fahrerfenster herein und begab sich dann seiner Wege.
Wer sich jetzt noch wundert, warum ich seit dem Tag so recht keinen Fuchs mehr schießen mag, dem kann ich auch nicht helfen. Viel lieber schau ich mir den kleinen roten Wildhund an, wo immer ich ihn zu Gesicht bekomme. Und speziell in England scheinen die Herren von Malepart zu wissen, dass ihnen von mir keine Gefahr dräut: wann immer ich einen Gast führe und auf eine Wiese komme, sehe ich nur noch eine rote Lunte im Gebüsch verschwinden. Komme ich aber allein dahergezockelt, dann setzen sich die Füchse auf ihre Keulen, wir sehen uns an und wünschen uns einen Guten Tag. Und hat der Fuchs dann auch noch einen Fasan im Fang, einen der vielhundert oder -tausend, die auf dieser profesionellen Flugwildjagd jährlich ausgewildert werden, dann wünsche ich ihm im Stillen einen recht Guten Appetit dazu. So habe ich eine viel größere Freude damit, die Füchse zu beobachten und zu studieren, habe auch meine alten Bekannten, die ich Jahr um Jahr wiedersehe. Und zunehmend sehe ich das bestätigt, was britische Forscher vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass der Fuchs nämlich kein echter Einzelgänger ist, er vielmehr in einem fein justierten, aber großflächig angelegten Sozialgefüge, ja, Rudel lebt.
Das Erlebnis mit dem Fuchs auf der Kühlerhaube hat Madame übrigens ebenso wenig losgelassen wie mich. Und jedes Mal, wenn ich sie und ihren Mann in späteren Jahren wieder traf, war unweigerlich die erste Frage: „Rapellez-vous: le petit renard sur le capot?“
Dass ich übrigens mich in diesem Sommer jagdlich so brav zurückgehalten hatte, das hatte einen höchst lohnenden Effekt. Im Arbeitszimmer meines Vaters steht im Eck ein großer, behäbiger Kamin, und auf dessen Abzug hingen immer die besten Böcke des Revieres. Nur wenn einer zur Strecke kam, der besser war als alle anderen, dann wurde der schwächste Bock herunter genommen, um dem Stärkeren Platz zu machen. Und als im Jahr des Fuchses die Blattzeit vorbei war, befand mein Vater, dass ich im nächsten Jahr einen „Kaminbock“ schießen sollte.
Das war mir natürlich Ehr und Freude, allerdings mit einem kleinen Aber: die besten Böcke der Adelegg, das waren druchweg recht hohe und ausnehmend gut vereckte, aber halt völlig ebenmäßige und damit für mich leider etwas langweilige Sechser. Ich hatte mich auf die Rücksetzer, auf die Abnormen kapriziert, und so brauchte es etwas Suchen, bis ich meinen Kaminbock fand.
‚Der Fahrradlenker’, so geschehen am Ölbergwald, des Jahres MCMXCIII Juli den 24.
Begonnen aber schon im Mai des selbigen Jahres: ich hatte mich mit Toni zu einer Frühpirsch verabredet und war zum Huggerhof gefahren. Von der Frühpirsch ist nichts Rares zu berichten, dafür aber vom Heimweg: ich war keinen halben Kilometer gefahren, da stand linkerhand neben der Landstrasse ein Reh. Das Glas lag auf dem Beifahrersitz, und das, was ich dadurch sah war nicht hoch, aber sehr dick. Ich wurschtelte mein Spektiv aus dem Rucksack und machte den Motor aus, der Vibrationen wegen. Das war nun ein völlig sinnloses Unterfangen, denn dass, was ich mit der 30fachen Vergrößerung sah, sorgte bei mir für einen satten Tremor: da droben, wo der Ölbergwald den Rinnebühl hinaufgeht, stand ein kapitaler und abnormer Bock! Von den Skizzenkarten meiner Kindheit hatte ich immer einen Stoß im Handschuhfach, und ein Bleistiftstummel fand sich auch. Nach einer hastigen Zigarette war ich soweit wieder ruhig, dass ich das, was ich da sah, skizzieren konnte: ausnehmend starke, schlecht geperlte und seltsam kurvig gebogene Stangen bis knapp über Lauscherhöhe mit winzigen, aber daumendicken Augenden. Danach bogen die Stangen fast waagrecht und mehr als handbreit nach hinten weg, um dann mit kleinen Markierleisten noch einen Schwung nach oben zu machen. Das Geweih schaute sich an fast wie ein Fahrradlenker, und damit hatte der Bock auch seinen Namen weg.
Das ganze G’wichtl war massiv bis obenhin, und trotzdem war es, konnte es kein junger Bock sein: grau das Gesicht, hell die Muffel, kraus die Stirnlocke, Dachrosen tief in den Schädel hinein, und vom Stangenansatz zog sich ein breiter, weißer Streifen über die Lichter hin bis fast zum Windfang, so daß es beinah aussah, als hätte der Rehbock Zügel wie ein Gams. Dazu ein massiger Wildkörper, der Träger kurz und waagrecht, die ganze Figur des alten Bockes aus dem Lehrbuch. Nach gut einer Viertelstunde zog er gemächlich in den Wald und war weg.
Als ich meinen Eltern zuhause den Bock beschrieb, fragte mich meine Mutter am Frühstückstisch, ob ich an diesem Morgen gejagert oder doch eher gesoffen hätte. Ich schwor mehrere höchstheilige Eide auf meine Nüchternheit und flehte sie an, mir und meiner Skizze doch bitte zu glauben. Sie ließ sich alles noch einmal haarklein berichten und kam dann zu dem Schluss: „Nach allem, was Du beschreibst, ist das ein blutjunger Bock: G’wichtl massig bis obenhinauf, buntes Gesicht und überhaupt: wenn da tatsächlich ein alter Bock und dazu noch guter Bock keine fünfhundert Meter neben dem Haus vom Jager auf die Wiesen tritt, warum hat den dann noch keiner je gesehen?“
Ich argumentierte, diskutierte, explizierte – es half nichts: Der Bock müsse jung sein, wenn er überhaupt so gut sei, wie ich es beschrieben hatte. Wo ihn außer mir doch noch nie jemand gesehen hätte, und so ein guter Bock wäre doch jedem aufgefallen. Selbst meine Erklärung, daß über der Wiese neben der Straße zwei große Kahlflächen im Bestand seien, an die wegen der übrigen dichten Vegetation kein Herankommen sei, idealer Einstand für einen alten Bock mithin, darum sei er ein Ungesehener – auch das fruchtete nichts. Denn meine Mutter rief umgehend den Bauern vom Ölberghof an, hinter dessen Haus diese Flächen lagen, und auch der – obwohl mit allen wilden Wassern gewaschen – hatte den Bock nicht gesehen. Jung also. Oder ein Hirngespinst. Die Diskussion wurde so heiß, dass sie richtig in einen kleinen Streit ausartete und mein Vater mich beiseite nehmen musste: „Schau, man hat sich schnell einmal geirrt bei einem Bock, das ist uns allen schon passiert. Sie weiß halt soviel mehr über die Rehe als Du, also gib halt nach.“ Nein, und punktum. Ich hatte gesehen, was ich gesehen hatte: der Bock war alt, und dabei blieb ich.
Ein paar Tage darauf – ich war wieder im Badischen bei meinem Sender – rief meine Mutter an: sie habe gemeinsam mit dem Rosmer Toni den fraglichen Bock gesehen, an genau der bezeichneten Stelle. Nicht sehr lange, aber lang genug zum Ansprechen. Meine Skizze stimme im Wesentlichen, der Bock sei sehr anständig, aber nicht so kapital, wie ich ihn beschrieben hätte. Und überdies sei er – und da sei der Jager mit ihr einig – bestenfalls zwei Jahre alt. Mir fiel schier der Hörer aus der Hand! Nun habe ich aber von meinem Vater eine gewisse Beharrlichkeit, um nicht zu sagen: einen granitenen Schädel geerbt. Daher ließ ich mich auch durch dieses doppelte vernichtende Urteil nicht überzeugen, und selbst ein nachheriger Beschwichtigungsanruf vom Toni, der Stein und Bein schwor, dass es wirklich ein junges Böckle sei, änderte daran etwas. Ich nahm mir den Freitag unter fadenscheinigsten Vorwänden frei, verließ am Donnerstag unzüchtig früh das Büro und fuhr wieder ins Allgäu.
Für mein ungewohnt frühes Ankommen im Elternhaus setzte es gleich das nächste Donnerwetter. Jagerei hin, Bock her: es gäbe Pflichten, die vor der Jagd kämen, und wenn ich es tatsächlich zu Wege brächte, mich wegen eines blöden – und dazu noch jungen – Bockes aus der Arbeit zu schwindeln, dann hätte ich noch einiges zu lernen! Ich verschmollte mich zum Toni und mit ihm in den Wald. Der hat mich auf einen Hochstand gesetzt und mir eine längere Therapiepredigt gehalten, an deren Ende ich zum Schluss kam: das Bockthema schneiden wir für geraume Zeit nicht mehr an.
Der Mai ging zu Ende, der Juni war fast vorbei, und ich war wieder wochenends im Allgäu. An einem Abend hatte ich wieder einmal die Freud’ meine Mutter führen zu dürfen. Den Ölbergwald, die Heimat des „Fahrradlenkers“, hatte ich wohlweislich und weiträumig gemieden, und so hatte meine Mutter auf den Almwiesen am Herrenberg einen recht guten und alten Bock geschossen. Es war grad allerletztes Büchsenlicht, als wir den Rinnebühl herunter zum Huggerhof fuhren. Ich wollte gerade zum Haus abbiegen, da hielt mich meine Mutter am Arm fest und sagte: „Da steht Dein Bock!“ Für das Spektiv war es schon viel zu dunkel, also versuchte ich mit dem 10x40 etwas auszumachen. Viel Licht war es nicht mehr, und der Bock nicht genau zu kennen: er hatte wohl die Form des Fahrradlenkers, aber er war irgendwie, nun ja, anders halt. Sollte ich mich tatsächlich geirrt haben?
Als wir droben beim Huggerhof mit dem Toni den Bock meiner Mutter ausgeladen hatten und noch bei einem Glas vorm Haus saßen, hechelten wir die ganze Suada noch einmal kleinfein durch, wogen Argument gegen Argument, Beobachtung gegen Beobachtung. Es blieb beim gleichen Stand: Zwei für jung gegen Einen für alt. Ich hielt daran fest: insgesamt war der Bock dreimal gesehen worden. Einmal gerade eben bei schelchtem Licht, ein weiteres Mal nicht sonderlich lang von Mutter und Jager, ein drittes Mal von mir über eine Viertelstunde bei bestem Licht und mit dem Spektiv. „Vielleicht isch genau des es Problem“, sagte der Toni. Wenn man so lange und immer nur mit dem großen Glas ein Stückl Wild ansprechen wolle, dann wüchse das weit über die Realität hinaus: „Muesch halt immr amol s’Spektiv gegs es Fernglas wechlse!“ Daß ich darauf zu einem Widerwort ansetzte, ließ bei meiner Mutter endgültig das Kragenknöpfl sausen: „Jetzt pass einmal auf, du verbohrter Hornochs! Wir haben den Bock gesehen und sagen beide, dass er jung ist. Du selber hast ihn grade gesehen und bist Dir auch nimmer sicher gewesen. Wenn Du wirklich so unbelehrbar bist, dann schieß den blöden Bock halt zusammen! Vielleicht lernst Du was dabei!“
Nein, ich habe es daraufhin nicht Tag und Nacht auf den „Fahrradlenker“ probiert. So vorgeführt werden wollte ich dann doch nicht. Wenn der Bock fallen sollte, dann nur, wenn er halt grade da stand und ich vorbeikäme. Ich kam oft vorbei, aber der Bock stand nie da, und auch der Toni bekam ihn nicht zu sehen. Der Fahrradlenker geriet beinahe in Vergessenheit. Ende Juli hatte ich mir drei Wochen Urlaub genommen um im Bayrischen und in Österreich zu blatten. Da aber am ersten Samstag dieses Urlaubs ein guter Freund seinen Vierzigsten mit einem prachtvollen Fest feiern wollte, war ich zuerst ins Allgäu gefahren, der Freund wohnte nur eine gute Stunde von den Eltern weg. Einer meiner beiden Schwäger war ebenfalls im Allgäu, und so verabredeten wir uns für den Samstag zu einer Frühpirsch und fuhren noch im Stockdunklen zum Jager hinaus. Eigentlich wollten wir direkt hinter dem Hof durch den Wald auf die Almen steigen und uns dort umschauen. Aber als wir fertig adjustiert beim Toni hinterm Haus standen, sagte er: „Etz kommet, etz gugge nr no kurz auf d’Wiesa rab, vielleicht schtoht em Bertram sei Bock do.“ Und tatsächlich: auf der Wiese unterm Ölberwald leuchtete es rot.
Der Toni hatte das Glas als erstes oben, und kaum hatte er durchgeschaut, beutelte es ihn am ganzen Körper: „Schnell schieße, des isch der Guete!“ Ich wollte meinem Schwager den Vortritt lassen, aber der lehnte ab, und da hab’ ich dann auch keine Widerrede mehr geleistet. Den Bock haute es im Schuss ins Gras, ein kurzes Schlegeln noch, dann war es aus. Hätte ich im Schulsport ähnliche Sprintleistungen gezeigt wie damals, als ich mit Riesensätzen die Wiese zum Bock hinaufgerast bin, hätten meine Noten im Fach „Leibesübungen“ besser ausgesehen. Ich wollte es jetzt wissen, wollte als erster am Wild sein, wollte als erster Sicherheit haben über Bestätigung oder Blamage. Keuchend kam ich beim Bock an: das Haupt lag Unterkiefer nach oben im Gras, das G’wichtl hatte sich in den Wiesenboden gegraben. Zitternd zog ich es heraus, wischte es sauber, betastete es: Dachrosen, dicke Stangen, die Perlung wie mit Sandpapier angeschliffen, daumendicke Augenden, waagrechter Knick auf Handbreite. Schob einen Finger in den Äser, fühlte nach und ließ dann ein wildes Siegesgebrüll heraus: Alt! Abnorm! Kapital!
Mein „Fahrradlenker“!!! Als mein Schwager und der Toni bei mir oben ankamen, hielt ich ihnen triumphierend das Haupt samt Bock daran entgegen. Mein Schwager grinste breit und wissend, der Toni aber schob den Hut ins Genick, kratzte sich am Kopf und sagte dann nur: „Sakrament. Hosch doch recht ghet!“
An eine Frühpirsch war nicht mehr zu denken. Umgehend war der Bock aufgebrochen und eingeladen, und im Triumphzug machten wir uns auf zum Elternhaus. Der Weg dorthin führte am Haus meines Schwagers vorbei, und er befand, dass es um halber Siebene in der Früh noch nicht statthaft sei, solcherart vor den Eltern zu protzen und zu prahlen. Wir machten Station bei ihm. Die Leber des Bockes lag mit reichlich Kümmel im brutzelnden Butterschmalz, die Nieren schwammen in einer dickrahmigen Senfsauce, und die Magnum eines alten Bordeaux aus Schwagers Keller rundete das Jagdfrühstück so wunderbar ab, dass wir erst gegen halb Zehn mit Blitzräuschen im Schädel bei den Eltern vorfuhren.
Meine Mutter stand reichlich konsterniert vor dem gestreckten Bock, umrundete ihn mehrfach kopfschüttelnd und sagte nur immer wieder: „Gibt’s doch nicht!“ Mein Vater stand grinsend daneben und freute sich mit mir an meinem dreifachen Triumph: ich hatte einen abnormen Kaminbock geschossen, ich hatte ihn richtig angesprochen, ich hatte mich nicht irre machen lassen. Von Wein, Bock und Morgen berauscht konnte ich es mir nicht verkneifen meine Mutter, während ich einen ganzen Film auf den Bock verknipste, zu fragen: „Wer hat jetzt was gelernt?“
Ihr „Du Frechdachs!“ kam nur noch halbernst heraus, und dann war’s ein breites Lachen! Mein Vater hat den Bock, als er ein paar Tage später ausgekocht war, eigenhändig auf den Kaminsims gestellt, dort steht er heute noch und dort lass ich ihn stehen, solange mein Vater lebt.
Ein kleines Nachspiel gab es aber noch zum „Fahrradlenker“, und das fand im späten Herbst des beschriebenen Jahres statt. In Baden-Baden erreichte mich ein Anruf aus dem Sekretariat meines Vaters: meine Mutter wünsche mich dringlichst am Samstag im Allgäu zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, worum es sich handelte, setzte mich aber brav am Samstag ins Auto und fuhr nach Hause. Als mein Wagen auf den Kies vor der Haustür rollte, stand meine Mutter schon mit einem diebischen Grinsen im Gesicht auf den Stufen und winkte mich mit dem Finger zu ihr her. Dann langte sie wortlos in die Jackentasche und drückte mir zwei Abwurfstangen in die Hand. Dem Petschaft nach waren es die Stangen eines recht jungen Bockes. Kranzrosen, starke Perlung, daumendicke Augenden, dahinter waagrechter Knick auf Handbreite und kleiner Schwung nach oben! Am Ölberg hatte es also tatsächlich zwei „Fahrradlenker“ gegeben: den Alten, den ich zuerst gesehen und zuletzt erlegt hatte, und seinen offensichtlichen Sohn! Der war es, den meine Mutter und der Jager gesehen hatten, den hatten vermutlich auch meine Mutter und ich im schlechten Licht am späten Abend gesehen.
Unter dem Haupt des alten „Fahrradlenkers“ auf dem Kaminsims im Arbeitszimmer meines Vaters liegen nun diese beiden Abwurfstangen und die Skizze, die ich damals im Auto angefertigt hatte und erzählen diese Geschichte hier. Bei mir zu Hause liegt schon ein Schild bereit, der irgendwann einmal G’wichtl, Stangen und Skizze aufnehmen wird, dann, wenn mein Vater nicht mehr lebt. Gott geb’, dass dieser Schild noch lange freibleibt.
WH
Stets der Eure.
„Heimatböcke“
Ich glaube, dass ich meinem Hergott eher dankbar sein darf, dass er mich da hin hat kommen lassen, wo ich aufgewachsen bin: ins Allgäu. Wohne ich auch schon lange nicht mehr dort, lebe ich da und werde ich da wohl immer leben. Auf den Postkarten sieht das Land recht idyllisch aus, mit seinem braunen Kühen und den Löwenzahnwiesen, aber hat man es erlebt, dann ist das Land so herb wie die Leute dort, so herb wie die Sprache. Sie hat nicht den Charme des Bayrischen oder die Biederkeit des Schwäbischen, aber dafür ist und kommt sie grad raus. Das ist mir alle Mal lieber.
Dieses Land, in dem ich als Büble gelebt habe und als junger Mann, dieses Land war nicht die erste Stätte meiner jagdlichen Sozialisation. Das war das Weinviertel, wie an anderer Stelle schon erwähnt wurde. Aber es war das Land, in dem ich gelernt habe, was Jagd heißt.
Anfangs war es etwas, das sich in Gegenständen manifestierte: Geweihe im Elternhaus, Hüte auf der Kommode neben der Haustür, Ferngläser, Patronenhülsen.
Später dann war Jagd das, was die Eltern taten. Und in diesem Tun war schon für mich als Kind spürbar, dass „Jagd“ etwas unerhört wichtiges, fast heiliges sein musste. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist so ganz untrennbar mit der Jagd verbunden, und zwar mit der Beizjagd.
Meine beiden Eltern flogen mehrere Beizvögel. Einige der Charaktere kenne ich nur aus aus Erzählungen, wie Taps und Ali, oder Dina, das Sperberweib meiner Mutter.
Andere aber aus eigenem Erleben: Freya, das Wanderfalkenweib beispielsweise, das im Falkenhaus wohnte. Dieses Falkenhaus stand an einer hohen Fichtenhecke im Westen des Elternhauses, und dieser Ort zog mich magisch an. Will sagen: ich zog meine Kinderschwester dorthin, mit aller Kraft, die meine Stampfbeine hergaben. Dann stand ich mit respektvollem Abstand vor dem Gitter, sah den großen Vogel auf dem Sprenkel stehen, und seine gelbumrandeten Augen waren helle Lichter im Halbdunkel seines Hauses. Leuchteten. Und brannten.
Mein Vater hatte offenbar bemerkt, wie sehr mich dieses Tier in seinen Bann zog. Eines Tages, als er mit Freya auf der Faust durch den Garten ging, sah er mich in der Tür stehen und winkte mich zu sich heran. Ich bin wohl recht zögerlich auf ihn zugegangen, denn es war das erste Mal, dass dieser große, geheimnisvolle, schöne und gleichzeitig furchterregende Vogel ohne ein trennendes, schützendes Gitter zwischen ihm und mir war. Mein Vater nahm mich an der Hand und führte mich zu einer großen Granitkugel, die als Abschluss eines Rosenbeetes vor dem Haus da lag. Darauf setze er sich, hob mich auf seinen Schoß und stellte Freya vor sich auf den Block. Dann zog er seinen großen Falknerhandschuh über meinen Arm und führte ihn ungemein langsam auf das Tier zu. Ich kann mich an kein Gefühl des Unbehagens in dieser behutsamen Annäherung erinnern, nur an eine große Spannung. Als mein Arm, von Vaters Hand geführt, beinahe die Brust des Vogels berührte, machte Freya einen Schritt und stand auf meiner Faust. Mein Vater hob meine Hand mit Freya langsam hoch, bis sie auf meiner Augenhöhe stand. Dann schob er mit der anderen, freien Hand ein Stück Fleisch zwischen Zeigefinger und Daumen des Handschuhs, und das große Tier beugte sein Haupt herab und nahm die Atzung an. Da war keine Angst, kein Schrecken, da war nur Zauber und Staunen, stilles, atemloses Staunen. Dieser eine Moment hat sich mir in die Seele geprägt, zum einen ob der Größe dieses Erlebens. Zum anderen aber – und das habe ich erst viel später begriffen – weil mein Vater in diesem Moment etwas Besonderes getan hatte: seine Tiere, seine Hunde und Pferde, besonders aber seine Beizvögel waren ihm ganz nah und wichtig. Denn der Greifvogel, vor allem wenn er ein Wildfang ist – wie es alle Greife meines Vaters waren – jagt nicht mit dem Menschen, weil der ihn dazu erzogen und gebogen hat. Er jagt mit ihm, weil er sich dazu entschieden hat. Und an diesem besonderen Tag hat mein Vater seinem Jagdgefährten sein Kind vorgestellt und gezeigt. Wenn ich heute über mein Jagen nachdenke, dann ist dieser Tag so etwas wie meine Initiation gewesen.
Es brauchte noch viele Jahre, bis ich im elterlichen Revier im Allgäu recht ans Jagen kam. Mit „hinaus“ wurde ich früh schon genommen, vor allem von meiner Mutter. Aber ein Gewehr war lange, lange nicht dabei. Mit einem Fernglas, einem Bleistift und den bekannten Skizzenblättern, die, die von links, von vorne und von rechts ein Rehhaupt zeigen, darauf das Geweih einzuzeichnen und nach Alter, Besonderheiten, Ort und Zeit genauest auszufüllen. So ausgestattet wurde ich auf den Hochstand gesetzt, damit ich lernte zu sehen. Erst als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, durfte ich dabei sein, wenn ein Bock erlegt wurde. Es war ein schwacher Gabler von zwei Jahren, und das Geweih liegt heute noch in meinem Kinderzimmer im Elternhaus.
Diese Beobachtungsstunden hatten aber neben dem Sehen lernen noch einen anderen Zweck: ich lernte das Revier kennen nach Namen und Orten. Und wenn dann in Internatsjahren bei Besuch oder Telefonat die Eltern erzählten vom Schwickartsberg, vom Braunkohler, von Schleifertobel und Zengerles Alm, da wusste ich um das „Wo“ – und manchmal sogar um das „Wer“.
Wie ich zu jagen begonnen habe, das steht in anderen Kapiteln dieses Buches zu lesen. Und wie ich meinen ersten Bock im elterlichen Revier jämmerlich angeflickt habe, ebenfalls. Nach diesem Debakel dauerte es eine gewisse Zeit, bis der Rosmer Toni, der Berufsjäger meiner Eltern, mich diese Scharte auswetzen ließ. Ich habe viel und gern mit ihm gejagt, aber es war immer Jagen unter Führung, und ich wollte endlich einmal allein und auf mich gestellt einen Bock schießen.
Als ich nach gut bestandener Matura aus dem Weinviertel wieder ins Allgäu übersiedelte, war ich stolzer Inhaber meines dritten Jahres-Jagdscheins und Führer einer Büchse. Und damit war ich – zumindest nach meinem Dafürhalten – ein relativ vollwertiger Jäger. Damit stieß ich im Elternhaus nicht auf vollste Zustimmung. Als ich meiner Mutter am ersten oder zweiten Tag nach der Heimkehr vorschlug, gemeinsam „hinaus“ zu gehen, stimmte sie sofort zu. Ich adjustierte mich zum Waidwerk und erwartete in voller Montur meine Mutter in der Halle. Als sie ebenso in voller Montur auftrat, sagte sie mit Blick auf meinen Stutzen: „Und was willst Du damit?“ Ich habe auf diese Frage damals nur ein relativ dämliches „Schießen!“ herausgebracht. Was genau die falsche – oder in den erzieherischen Ohren meiner Mutter richtige – Antwort war: „Schießen willst Du? Meinetwegen. Wenn ich es Dir erlaube. Und bevor ich es Dir erlaube, musst Du mir erst einmal beweisen, dass Du einen Bock richtig ansprechen kannst. Wir werden also ab jetzt immer wieder gemeinsam gehen, Du sprichst an und gibst frei oder nicht. Ich schieße alles, was Du mir ansagst. Und hinterher sage ich Dir, ob das in Ordnung war oder nicht. Außerdem will ich dann noch sehen, dass Du aufbrechen, aus der Decke schlagen, zerwirken kannst. Wenn Du das kannst, dann zeigst Du mir, ob Du daraus auch noch etwas Essbares herrichten kannst. Und wenn Du das auch noch kannst, dann lass ich Dich jagen.“
Das wurde ein spannender Sommer. Es gab einige Abschüsse, die nicht in Ordnung waren. Es gab nie ein Donnerwetter, sondern genaue Erklärungen. Es gab den ein oder anderen Abschuss, der richtig war. Und wenn meine Mutter von mir den Erlegerbruch mit einem „Passt!“ annahm, dann waren das ganz große Augenblicke. Mein Vater, der in allen anderen Dingen erheblich strenger mit uns Kindern war als meine Mutter, mein Vater war in jagdlicher Hinsicht sehr viel nachsichtiger. Mehr als einmal quittierte in späteren Jahren der Jagdherr einen Fehlabschuss mit mehreren zugedrückten Augen. Ich weiß nicht, ob es jemals Diskussionen zwischen meinen Eltern gegeben hat über meine jagdliche Ausbildung. Es ist mir auch egal: so sehr mir damals die – von mir als Gängelei perzipierte – Haltung meiner Mutter gestunken hat, so dankbar bin ich heute darum. Wobei es von Beginn der „Ausbildung“ an drei Jahre gedauert hat, bis ich meinen ersten Do-it-yourself-Bock erlegt habe. Und selbst der fiel noch bevor ich von meiner Mutter und – ja, wie sagt man nun: Lehrprinzessin? – freigesprochen worden war.
‚Der Eigene’, So geschehen da, wo es „Im Blitzloch“ geheißen, des Jahres MCMXC Juli, den 12.
Es war in den sengendsten und drückendsten Hundstagen. Ich hatte noch aus der Redaktion den Jager Toni angerufen, um mich mit ihm zur Abendpürsch zu verabreden. Was nun genau der Grund war, das weiß ich heute nicht mehr: war er zu müde oder anderweitig verhindert – egal. Seine Antwort war so oder so ein Stromschlag: „Woisch was, Du hocksch de heit alloi naus. Hocksch de irgendwo na, Sennberg oder so.“ An dem Nachmittag ging in der Redaktion nicht mehr viel, und ich bin mir recht sicher, dass ich mit irgendeiner faulen Ausrede meinen Arbeitsplatz deutlich vor der Zeit verlassen habe. Den Eltern war schnell etwas erzählt von wegen Rosmer und rausgehen, dann war ich im Auto und im Wald. Der Sennberg, den mir der Jager genannt hatte, ist eine kleine Alm, auf der der Wind immer so bläst, dass man sie eigentlich nur wegtechnisch gesehen von hinten her angehen kann. Will sagen: man muss die gesamte Alm auf einem Forstweg umschlagen, um in guten Wind zu kommen. Der besagte Weg führt aber durch die Wände eines der in dieser Endmoränenlandschaft häufigen Tobel, und die Chance, dort etwas zu vertreten sind so hoch wie die Wände steil. So fuhr ich den gesamten Weg bis zum Einstieg in die Almwiesen hinter und stellte mein Auto dort ab.
Man kennt das. Da ist einem ein bestimmter Pirschweg oder Hochsitz zugewiesen, und steht man erst davor, hat man das sichere Gefühl: Heute nicht! Genau so ging es mir an diesem Abend. Ich spekulierte ein wenig in die Wiesen hinein und wusste: heute geht wenn, dann was im Wald. Zudem wehte der Wind an diesem Abend ausgerechnet in die andere Richtung, also ließ ich die Alm hinter mir und wandte mich waldwärts.
Geht man vom Sennberg aus in den Bestand hinein, immer schön brav in der Schicht, dann hat man mit vielleicht siebzig Schritt einen Fichtenhochwald durchmessen und kommt auf ein Schlägle hinaus, das nach Osten hin steil ansteigt. Ein und einen viertel Hektar misst die Fläche, kein Schlag, ein Schlägle eben, genannt das Blitzloch. Die nördliche Hälfte dieser Fläche ist relativ frei, Farnwedel und Graswerk halt, die südliche Hälfte war damals eine schon recht ordentliche Kultur von vielleicht zehn oder fünfzehn Jahren. Exakt an der Grenze zwischen Freifläche und Verjüngung stand eine hohe Kanzel. Eigentlich hatte ich vorgehabt, das Blitzloch hinauf zu pürschen und dann überm Grat in ein paar Freiflächen und Schneisen hineinzupürschen und das ganze im Wurzefauteuil einer alten Buche im Tobel unten ausklingen zu lassen, wo ich einen Wechsel wusste. Wurzelfauteuil, Wechsel, Buchenaltholz – ja, das klingt ganz nach Gagern und genau so war es auch geplant: mein erster eigener, ganz selbst erjagter Bock sollte ebenso geschossen werden wie „Auch einer“, der „Falsche Demetrius“, der „Slahziz“ und wie sie alle geheissen haben mögen im Silioutz, im Tusti Dol, im Brlog. Das mag vermessen sein, und es ist mir nebstbei nie gelungen einen Bock nach Gagern’scher Manier zu. Aber man darf ja träumen.
Für diesen Abend aber war dem Träumen ein schwerlastendes Hindnernis entgegengesetzt: die drückende Hitze hatte dem Himmel die Farbe geschmolzenen Bleis übergezogen, und die Wolkendecke kam immer tiefer herab. Kein Wetter für die steilwandigen Nagelfluh-Tobel des Reviers. Ich strich Gagern zugunsten von Frevert und setzte mich auf die Kanzel am Blitzloch. Wobei ich Gagern freilich zur Ansitzlektüre im Schnerfer hatte. Zum Lesen kam ich aber an diesem Abend nicht: Der Himmel hatte sich vom lastenden Bleigrau zu dem Violett gewandelt, wie es der Pfarrer in der Karwoche als Messgewand trägt, und von dahin zum karfreitäglichen Schwarz. Wind war aufgekommen, Brise zuerst, dann stärker werdend, bis an den Sturm. Ich saß auf meiner Kanzel und gab mich dem Schauspiel hin: hoch oben über den Wolken zuckte es schon loh, bald war das ganze Firmament über dem schwarzen Schleier hell erleuchtet, und dann fuhr der erste Strahl gleissend herab. Vier oder fünf Lichtäste waren in den Wolken zusammengetroffen und sausten im lichten Keil weit hinaus in die Täler. Stumm zählte ich bis zur Sieben, dann kam der Schlag dazu. Kaum verhallt, warf der Himmel den nächsten Blitz hinterdrein und so ging es Strahl um Krach und Schlag um Strahl. Aufs Mitzählen hatte ich längst vergessen, ich sah auch so, dass das Wetter schnurgerad auf mich zuhielt. Kurz kam mir noch der Gedanke, dass Nomen des Ortes auch Omen sein könnte, und das ein Blitzloch beim Gewitter nicht ganz so sicher sei wie Abrahams Schoß. Doch bevor ich diesem Gedanken recht Form und Folge geben hätte können, wurde es still, kam die Stille, die das Große Fechten am Himmel kündet. Und in dieser Stille sah ich die Jagd.
Überall da, wo man es in ganz früher Zeit „Germanisch“ hieß, geht die Sage von den Unsteten und Unwegsamen, die mit Odin reiten und reiten und immer so fort, ohne Anhalt und Ziel, immerwährend in Folge von Lust und Fluch. Wird ihnen auch Beute, so wird nie Erfüllung daraus, und halten sie Rast, so ruhen sie nimmer.
Odin, Wotan, Muotis – viele Namen hat der Einäugige, der sie leitet. Muetes Heer heißt man die Jagd bei uns im Gäu, und wirklich und wahrlich ritten die Ruhlosen vor mir über die Schneid: falb und fahl die Rösser, geduckt darauf die Schemen. In fliegende Fetzen gehüllt nahmen sie den Grat als wär’s eine Hecke oder ein Graben. Hugin flog vorneweg und Munin, hinterdrein deren Brüder und Schwestern, und hoch in den Lüften war ein Schreien zu hören, ein Rufen und Tönen von Hörnern. Einige wenige waren es erst, Spitze der Schar, dann mehr und mehr in breiter Front kamen die Nebelfetzen über den Berg geritten, glitten hinter mir in die Finsternis und ins Tal hinaus, weiter nach Osten hin.
An diesem Abend im Blitzloch habe ich aber nicht nur gelernt, dass die Sage von Muetes’ Heer wilder Jagd ihren wahren Kern hat. Denn als Fahrt vorüber war und das Gewitter noch einmal mit verstärkter Kraft losbrach, sich in Minuten verbrauchte und verflog, als dann, nach starkem und kühlendem Schauer die Wolken aufrissen und die Sonne immer noch kraftvoll genug war um wärmende Strahlen in den triefenden Wald zu werfen, da stand in jedem Tobel, in jeder Scharte, in jeder Falte ein altes Weib und rührte im Kessel Fledermaushaar, Hundszahn, Otternzunge, Stacheligel, Eidechspfot’ und Eulenflügel zusammen, dass hoch stieg der Dampf säulenweis’ in den Abendhimmel hinein. Und war es auch im Jahre MCMXC: ich bin sicher, dass unten in den Höfen und Häusern manch einer in den Berg schaute und still das Kreuz schlug, weil wieder die Wetterhexen waren am Werk, am unheiligen.
Ich sah und schaute und staunte, weil sich die Sagenwelt meiner Kindheit, die Schauergeschichten am Kinderbett, die Schlaf raubten und Schwertraum brachten, die aber dennoch immer und immer wieder erbettelt wurden von den Schwestern, weil dieses Geheimnis sich mir gezeigt hatte. Und haben Geheimnis und Heimat die selbe Wortmutter im Heim, und war mir Heimat dank dem Geheimnis, dessen teilhaftig ich nun war werter und wärmer. Und in all dieser romantischen Schwärmerei glotzte mich schräg aus dem Jungwuchs ein Bock an.
Ich hatte damals mit den ersten Gehversuchen in Sachen Photographie begonnen und beschlossen das zu werden, was ich bis heute nicht geworden bin: ein großer Wildphotograph. Unter kompletter Überziehung meines nur von schmalem Volontärsalär gespeisten Kontto hatte ich mir aus zweiter Hand eine Nikon-Box gekauft, und aus brüderlichem – und zugegebenermaßen unwissenden – Erbe hatte ich ein 400mm-Novoflex-Teleobjektiv entnommen, ein elendslanges, unhandliches Ding. Diese beiden Bestandteile meiner Ausrüstung schraubte ich in der Kanzel zusammen und legte optisch auf den Bock an. Der hatte inzwischen seine Entlaubungsaufgabe am Brombeerhag wieder aufgenommen, und mit guter Auflage und bei anständigem Licht verschoss ich einen ganzen Film auf ihn. Auf den Bildern war nachmalig nicht viel mehr zu sehen als halt ein Bock im Wald.
Als die Kamera endlich voll war, kam mir dann doch noch die Idee, den Bock vielleicht auch einmal mit Glas und Spektiv genauer anzusehen: mein alterGucker wies etwas, das nicht wesentlich über die Lauscher hinausging, aber unten recht massiv war. Das Spektiv gab da schon mehr her: völlig blankgefegte Stangen, keine Perlung, nur noch Riefen, die vom Augend hinab direkt in den Schädel des Bockes zu laufen schienen, denn der breitwulstende Kranz der Rosen waren einem steil abfallenden Dachtrauf gewichen. Ein graues, verwaschenes Gesicht dazu, die Stangen tief in den Schädel gedrückt: das war das letzte, das wichtigste Zeichen des alten Bockes, so hatte es mir der Rosmer Toni bei unzähligen Pürschen und Ansitzen eingetrichtert.
Der Schuss war keine hohe Kunst, die Auflage für Lauf und Ellbogen sicher und fest. Das Absehen stand hinterm Blatt, und im Knall machte der Bock eine hohe Flucht, ein paar junge Fichten wackelten noch, dann war Ruhe. Im Wald. Bei mir nicht. Meine Hände zitterten nicht, sie wackelten nicht, sie oszillierten. An ein Nachrepetieren war nicht zu denken, an eine beruhigende Zigarette ebenso wenig. Den Schuss hatte der Bock, das wusste ich, und einen guten. Passend war er auch, da war ich mir sicher. Die mütterliche Rüge, die ich unzweifelhaft zu erwarten hatte weil ich ohne vorherige Erlaubnis seitens der Jagdherrschaft allein und ungeführt einen Bock geschossen hatte, diese Rüge würde erträglich ausfallen. Aber ich hatte allein, ohne Führung, ungestützt und ungeschützt vor allen Fehlern einen Bock geschossen. Das reicht für Tremor und Delirium.
Irgendwann ist auch die größte Adrenalindosis verbrannt und verbraucht. Als ich wieder relative Kontrolle über meine Extremitäten hatte, stieg ich von der Kanzel herunter, repetierte eine neue Kugel ins Lager meines Stutzens und ging zum Anschuss. Rotblasig und hell leuchtete der Lungenschweiß vom Brombeerlaub. Der Bock lag. Aber nicht am Ort.
Mit einem Fünferl mehr Erfahrung – Pardon – mit einem Fünferl weniger Gier und Hitze hätte jeder andere gewartet, bis der Bock aus den Brombeeren heraus auf die Freifläche gezogen wäre und hätte ihn dort geschossen. Nur ich halt nicht, und so musste ich hundlos den Bock im dichtesten Gewachs nachsuchen. Ich spähspekulierte mir die Augen aus dem Schädel: mehr als den Anschussschweiß konnte ich nicht finden. So ging ich halt irgendwann auf alle Viere nieder, und wie ein Hund habe ich mit tiefer Nase meinen Bock gesucht, bin der Fährte gefolgt unter den Bormbeeren durch, um eine jungstachlige Fichte herum hangab, bis ich irgendwann etwas schmales, behaartes unter meinen Händen fühlte: der Hinterlauf.
Ob es Viertel- oder ganze Stunden später waren, dass ich den alten Gabler oben auf die Schneid gezogen hatte, weiß ich nicht mehr. Und wie spät es war, als ich beim Toni damit ankam, auch nicht. Der haute mir erst einmal ein Waidmanns Heil auf die Schultern zum ersten eigenen Bock, dass mir das Schlüsselbein knirschte. Dann kippte er mir einen Schnaps in den Schädel, weil ich doch recht bleich aussah. Und anschliessend kratzte er sich am Kopf und sagte: „Hilft alles nix, den miesse mr em Fürscht und dr Fürschtin zoige. I komm mit!“
Der Bock lag sauber gestreckt auf dem Kies vor der Haustür, als ich den messingnen Klopfer gegen das grünlackierte Holz fallen ließ. Meine Mutter machte auf, sah den Bock, sah meinen Bruch am Hut, sah meinen etwas betretenen Gesichtsausdruck. „Du allein?“, mehr sagte und fragte sie nicht. Wortlos ging sie zu Wild, nahm den Bock in genauen Augenschein, und nach einer Ewigkeit kam das Wort, das mir heute noch mehr gilt als manches Waidmannsheil: „Passt!“
Mein Vater, der sich das Ganze mit nur schwer verhaltenem Grinsen in der Haustür angesehen hatte, tat einen besonders guten und recht alten Rotwein heraus. Die Leber des Bockes musste ich freilich allein mit Apfelscheiben und Zwiebelringen braten. Wir haben sie auf den Stufen der Haustür sitzend vor dem gestreckten Bock verzehrt. Ich schmecke sie heute noch.
Der Begriff „Heimat“ ist arg strapaziert, und auf die Frage, was er eigentlich bedeutet, gebe ich zu allererst eine Antwort: das elterliche Revier. Dann erst kommen Elternhaus, Freunde, Spache, Land. Sie stehen nur um ein Weniges zurück hinter dem Wald, den Almen und Wiesen. Aber wann immer ich Heimweh hatte, dann zuerst nach der Adelegg. Vor allem meine Mutter hat sie mich gelehrt auf langen Gängen, besonders in der Blattzeit. Am Morgen setzten mein Vater oder der Berufsjäger uns irgendwo im Revier ab, und für den Abend war eine weitere Stelle besprochen, wo wir wieder aufgeklaubt würden. Dazwischen lag ein Tag im Wald, abseits der Forststraßen, auf Pürschsteigen in den Tobeln, auf den Almen Herrenberg, Zengerles und Sennberg, in Hansmartins Wäldele, am Stinnes, am Hochkopf und in hunderttausend anderen Ecken und Winkeln, die alle ihren Namen und ihr eigenes Wesen hatten: da gab es Tobel, in denen auch Sommers noch Schnee lag, steile Leiten, raume Hölzer. Da eine Quelle, dort ein Brunnen und dazu ein Vesper aus der Tasche, und an hohen Tagen ein Besuch beim Bauern auf ein Glas Milch und ein Butterbrot. Die Gänge waren manchmal zäh, vor allem für meine Mutter, die ein irgendwann müdgelaufenes und dementsprechend brummeliges Kind hinter sich herschleifen musste. Aber sie wusste dann doch immer einen Fleck, wo frische Walderdbeeren zu brocken waren oder die saftigsten Him- und Brombeeren im sonnigen Schlag standen oder der Waldmeister wächst.
Sie ging vorneweg, ihre – und heute meine – Büchse über der Achsel, einen Bergstecken mit einer Hirschgabel oben drauf in der Hand, der sozusagen ihr Dirigentenstock war. Mit dem zeigte sie mir die Fährten im Waldboden und las sie mir vor, mit dem wies sie mir Wechsel und Fegstellern oder zeigte auf eine Tollkirsche, die voll schwarzer Beeren hing: „Was heißt das?“ - „Weiß ich nicht.“ – „Die Tollkirsche ist nicht verbissen worden, das heißt, dass in diesem Revierteil kein Hochwild mehr steht!“ Mit ihrem Stecken wies sie mich einzuhalten und still zu stehen, wenn vor ihr eine Bewegung war, mit dem Stecken deutete sie vorsichtig nach dem Wild, denn mit der blanken Hand darf man das nicht, weil das Wild die helle Bewegung sofort sieht. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich heute noch auf der Jagd jedem, der mit der Hand nach dem Wild weist, den Arm nach unten drücke und ihn bitte mir anhand besonderer Geländemerkmale zu beschreiben, wo etwas steht: im Gegenhang die einzelne Lärche, links drunter der Baumstumpf, und zehn Meter rechts davon steht der Bock! So findet man das Wild erheblich besser, als wenn man dem Fingerzeig eines Menschen folgt, der ein paar Meter neben einem steht.
Der Bergstecken meiner Mutter hatte aber noch einen anderen Zweck: manchmal, wenn auch selten, aber manchmal geschah es, daß ich ein Stück Wild entdeckte, das meine Mutter nicht bemerkt hatte. Dann musste ich nur den Stecken, den sie immer waagrecht nach hinten in der Hand hielt, anfassen, und augenblicklich stand sie still und lies mich sie einweisen. Das dann waren Momente, in denen ich ungeheuer stolz war.
Als ich selber den Jagdschein hatte und eine Büchse führen durfte, da kamen mir diese Gänge sehr zu Gute, denn ich kannte das Revier recht genau. Trotzdem gab es immer noch ein paar Ecken, an denen ich noch nie gewesen war, und die hat mir der Rosmer Toni alle gezeigt. Als er bei uns anfing, war ich vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Und bis dahin waren die Berufsjäger sehr ernste und respektheischende Männer in Lederhosen und Försterjacke. Der Toni aber war ein junger und gutaussehender blonder Kerl mit blitzblauen und immer lachenden Augen, derentwegen er recht bald landauf landab beim Weibsvolk der „scheene Done“ hieß.
In der Schule lief es damals ganz hundshäutern schlecht bei mir, und ich hatte in einer unvorsichtigen Minute den Eltern vorgemault, dass mich das blöde Abitur sowieso nicht schere, und ich mit Mittlerer Reife ein Handwerk lernen wolle. Mein Vater quittierte das mit den Worten: „Handwerk werd’ ich Dich lehren. Du hast keine Sommerferien, Du gehst für vier Wochen ins Holz und für vier Wochen dem Rosmer zur Hand!“ Was als Abschreckung gedacht war hatte mir soviel Spaß gemacht – und war neben bei auch noch gut entlohnt – dass ich es seitdem Sommerf für Sommer so hielt. Als ich sechzehn wurde, hatte mein Vater im Betrieb rundschreiben lassen, dass der Bertram ab dato nicht mehr zu duzen sei, sondern als Graf Bertram zu siezen. Das passte mir speziell beim Toni und bei den Holzleuten überhaupt nicht. Wie hätte sich das auch angehört: „Graf Bertram, nehmet se mol a Sappie und ziehet se den Fichtawipf do rum!“ Unmöglich. Und so war klar: ich wollte weiter geduzt werden. Als ich dem Herrn Rosmer sagte, kam seine Antwort: „Des isch mir reacht, aber bloß, wenn Du mi au duzesch!“ Von dem Tag an sind wir nicht mehr als angestellter Berufsjäger und Sohn des Jagdherrn „hinaus“ gegangen, sondern als Freund und Freund. Und wir sind viel gegangen!
Telefon: „Done, ganget mr raus heit obend?!“ – „Ha scho, bisch um fümfe do!“ Und dann gings entweder quer durchs Revier oder gemeinsam auf einen Hochstand, der binnen kürzester Zeit vor schlecht verhaltenem Lachen vibrierte: ein blöder Witz gab den anderen, und die heilige Ernsthaftigkeit des teutschen Weydwercks war – wie der Bayer so schön sagt – tschari! Trotzdem hat es häufig genug geklappt bei solchen Gelegenheiten: zweimal sogar mit Doubletten. Das erste Mal saßen wir gemeinsam auf einer offenen Kanzel, die so an ein Waldeck gestellt war, dass man die beiden Teile einer rechtwinkelig verlaufenen Wiese einsehen konnte. Auf meiner Seite trat ein schwacher Jahrling aus, und ich stupfte den Toni an: „Bei mir schtoht en Bock.“ - „Bei mir au.“ – „Ebbes rechtes?“ -„Noi.“ – „Ha, bei mir au it. Ond was mache mer jetzt?“ – „Ha, Du nimmsch Dein Bock, und i nimm dr meinige.“ Es brauchte noch nicht einmal ein verständigendes Auf-Drei-Zählen. Simultan fielen die Schüsse, und zur Rechten sah man wie zur Linken zwei ganze Böcke niedersinken.
Die zweite Doublette mit dem Toni war deutlich aufregender: wir hatten an einem Morgen Ende Mai den flacheren Teil des Revieres abgepürscht und spazierten gemütlich über eine mehrere Hektar große Freifläche mit Wiesen und Weiden. Ellmeney heißt dieser Ort von Alters her und war somit einst die Gemeindeweide oder Allmende der umliegenden Dörfer. Auf einer der Wiesen standen friedlich beieinander zwei Rehe. Das Glas zeigte einen Bock und eine Gaiss. Der Bock war nix Rares: ein älterer Kumpan mit schwachem G’wichtl, ein passender Abschussbock. Und während wir auf ihm herumspekulierten, sah bei der vermeintlichen Gaiss etwas, was man bei einer Gaiss gemeinhin nicht sieht: einen hellen Strahl unter dem Bauch, der nach vorne plätscherte: „Done, gugg amol die Goiss a, die soicht wie en Bock!“ – „Die soicht it blos wie en Bock, die isch en Bock!“ Ein Knöpfler wars, der da neben dem Alten in der Wiese sich erleichterte. „Bertram, woisch was, jetzt nemmsch dr Jährling, dann repetiersch, dann nemmsch dr Alte!“
Ein Zaunpfahl stand kommod zum Anstreichen da, und weit wars auch nicht. Auf den Schuss hin warf des den Jahrling nach hinten, ich repetierte eine neue Kugel in die Kammer und schickte sie dem Alten aufs Blatt, der sich im Schuss auf die Keulen setzte. Ich hatte bereits nachgeladen und war schon wieer mit dem Fadenkreuz auf dem Blatt des alten Bockes, als mich der Toni an der Schulter packte: „Lass dr Alte, der isch glei hi, ond guck bessr noch dem junga Bock!“ Der Knöpfler, den es im Schuss umgeworfen hatte, war inzwischen wieder hoch geworden und flüchtete dem Wald zu. „Zefix, der hat doch Schweiß am Blatt, ich seh’s genau“, rief ich. „It schiesse!“ befahl der Toni und schickte seine stets frei bei Fuß laufende BGS-Hündin Diana mit einem knappen: „Hopp, fang en!“ hinterher. Das Hundle schoss los, tauchte auf der Schweißfährte in den Wald hinein und nach kurzem hörten wir den Standlaut. Noch bevor wir am Bail angelangt waren, hatte Diana den Knöpfler an der Drossel niedergezogen und abgetan. Beide Böcke hatten Schüsse, die sauber im Leben saßen. Aber beim Aufbrechen des Knöpflers eine kaum verletzte Lunge zu Tage kam war klar, dass es sich hier um einen Hohlschuss gehandelt haben musste.
Ich habe umgehend das Geschoss getauscht und seitdem kein solches Erlebnis mehr gehabt.
‚Der Marschierer’, so geschehen am Kaltenbrunn, des Jahres MCMXCII Juni den 27.
Dieser Kaltenbrunn liegt unweit der Ellmeney, und dort hat sich ein anderes schönes Stückle mit dem Toni erreignet. Der Kaltenbrunn ist ein hübsch steiler Hang mit altem Mischwald, den wir ihn von oben her bepürscht haben, denn dort führte eine Forststrasse entlang. Unten lief der Hang in eine große, bürstendicke Fichtenkultur hinein, und darum ließ man dieses untere Ende des Kaltenbrunn in Ruhe. Das war einer der Revierteile, die ich eben noch nicht kannte. Dorthin wollte der Toni an diesem Tag in der Blattzeit, wobei es für echte und richtige Blatterei noch zu früh war: zum einen in kalendarischer Hinsicht, denn vor dem 3. oder 4. August ging bei uns aufs Blatt recht wenig, zum anderen war es aber auch für mich von Rang und Alter her zu früh zum richtigen Blatten. Das war den Gästen der Eltern vorbehalten, die die bestätigten guten Ernteböcke schießen sollten. Ich durfte an den Rändern des Revieres das Pfeiferlspiel üben, und mir war es recht. Da gingen nämlich die alten, heimlichen und verdrahten Kunden, an denen ich damals wie heut mehr Freude hab als an jedem ebenmäßigen Sechser, sei er noch so kapital.
An diesem 27. Juni hatten Toni und ich den ganzen Morgen über unser Glück an mehreren Ecken des Revieres versucht und waren ohne Erfolg und Anblick geblieben. Wir waren bereits auf dem Heimweg in Richtung Huggerhof – so hieß des Jagers Höfle – weil wir wussten, dass in etwa einer Viertelstunde der Metzger des Dorfes die Wienerle aus dem Rauch holen würde, und zwei Pärle solcher rauchwarmer Würste schwebten einem jeden von uns beiden als Frühstück vor. So gondelten wir durch den Friesenhofer Wald dahin, als der Toni plötzlich den Wagen zum stehen brachte, mich kurz ansah und dann sagte: „Doch, des probiere mr jetzt no.“ Ich sah ihn reichlich belämmert und verständnislos an, aber da war er schon zur Autotür draussen, hielt mir den Schlag auf und zog mich am Rockärmel aus dem Jeep. Für eine Weile ging es auf dem Forstweg dahin Richtung Ellmeneyer Wiesen, aber dann bog der Toni in eine völlig verwachsene Gasse eben jener Bürstendickung ein, die den Kaltenbrunn nach unten hin begrenzte.
Das war ein saures Pürschen, wenn man dieses Wort überhaupt für die mehr brechende als schleichende Fortbewegungsart hernehmen will, die die jungen Fichten uns aufnötigten. Und während ich da so durchs Gedachs mich hinter dem Toni herkämpfte, die Unterarme mit Nadeln gespickt, weil ich sie zum Schutz vors Gesicht hielt, da kamen die typischen, philosophischen Gedanken, die immer in solchen Situationen auf der Jagd kommen: Was, bitteschön, mache ich hier eigentlich? Und bis ich da wieder heraussen bin, sind die Wienerle beim Metzger fade, kalte Leichen in der Kühltheke. Böcke gibt’s hier bestimmt auch keine mehr, wenn wir aus der Dickung raus sind, weil wir alles vertrampelt haben werden, was im Umkreis von dritthalb Stunden Wegs auf den Läufen ist. Was also, was soll das hier werden?
Irgendwann hatten wir die Fichtenkultur endgültig durchdrungen und schüttelten uns ersteinmal das Nadelwerk aus Kragen und Ärmeln. Wie wir uns dann umsahen, merkten wir, dass wir an einem ganz heissen Eck gelandet waren: alles, aber auch alles sah hier nach Einstand und Rehbock aus, nach alt und gewitzt. Der Hang stieg steil vor uns an, unter den alten Bäumen wuchs halbhohes Gras, hier und da ein paar Brombeerbuschen, kleine Stauden da, wo das Licht bis zum Boden vordrang. Alles,
was ein Bock braucht, alles gab es hier: Deckung, klare Grenzen, Einstand, Äsung. Wir pürschten uns zentimeterweis den Hang hinauf, alle sonnebeschienenen und damit bewachsenen Platzeln säuberlich meidend, immer schön leise auf der Nadelstreu dahin. Ein paar sachte Schritte, dann stehenbleiben, lugen und lauschen. Bricht irgendwo Astwerk, schimpft die Drossel? Nichts? Leise weiter.
Beim dritten oder vierten Standel, das wir so machten, war es mir, als hätte ich weiter oben im Hang eine Bewegung gesehen: ein schmales, rotes Huschen nur, kann auch ein Sonnenstrahl gewesen sein, weiß nicht, langsam weiter, Schritt vor Schritt gesetzt. Da wieder: wieder ein roter Strich und dahinter ein zweiter, jetzt hören wir auch das Rascheln im Laub, denn weiter oben stehen hohe Buchen. Still stehen, nicht mehr bewegen jetzt. Alle Sinne gespannt, der Atem geht flach, das Herz pocht in den Schläfen. Rings im Reigen geht’s da droben, der Bock treibt die Gaiss, soviel ist klar, aber was für ein Bock? Wir drücken uns seitab weiter in den den Bestand hinein, weg vom Licht, tiefer in den Schatten der Bäume. Aufrechtes Gehen ist schon nicht mehr möglich: die Fichten hier sind noch keine alten Tanten, und die Äste reichen noch tief herunter. Auf allen Vieren schieben wir uns zentimeterweis bergauf, und finden bald den Grund dafür, dass wir nur rote Striche sehen über uns und kein ganzes Reh: ein alter Hohlweg mit steilen Rändern zieht sich schräg durch den ganzen Hang, und genau hinter dieser Kante sind Bock und Gaiss zu Gang. Zwischenzeitlich hören wir sie weit schräg über uns, also richten wir uns kommod an der Böschung ein: der Waldboden ist weich, Moospolster bettet den Lauf des Stutzens sanft und sicher: bequemer kann keine Schießstatt sein. Höher in den Hang hinein pürschen, das hieße in die Buchen und das dürre Laub am Boden kommen, hieße unweigerlich Bock und Gaiss vertreten. So passen wir zu.
Oben im Hang ist das Getrappel und Geflüchte verstummt. Ob die beiden noch über uns im Hang sind? Nichts ist zu hören, kein Amselschlag, kein Finkenruf. Die Sonne heizt auch hier im Wald schon mächtig ein, und langsam keimt der Gedanke auf ans Aufgeben, ans Heimgehen, ans Gutseinlassen. Einmal noch mit dem Glas den Hang durchkämmt, und beide packen wir uns im selben Moment am Arm: weit droben zieht es rot durchs grüne Laub. „Dr Bock“ zischt der Toni aufgeregt. „Was isches für oiner?“ – „Ka i it seah!“
Ich habe das Glas meines Stutzens auf höchste, fünffache Vergrößerung geschraubt, der Sicherungsflügel ist herumgelegt, und mit dem Absehen folge ich der Bewegung oben in den Buchen. Die Läufe sind zu sehen, mal mehr und mal weniger vom Rest, ein oder das andere Mal habe ich sogar das Leben frei, aber das Haupt des Bockes bleibt verborgen im Laub. Endlich verhofft er droben, die Bewegung hinter den Blättern zeigt, dass er das Haupt schüttelt, um die Fliegen zu vertreiben, die jetzt mit zunehmender Hitze lästiger werden. Mit Glück bringen sie uns den Bock näher, denn fünfzig Schritt über uns ist ein großer Fleck, über und über mit Farn bewachsen. Da geht das Wild an heißen Tagen gern hinein, weil der Farn alles Geschmeiss abhält. Aber der Bock denkt nicht daran, er bleibt unverrückbar stehen und wehrt sich gegen die Fliegen, so gut es geht. Und endlich nimmt er das Haupt herunter um zu äsen. Mich druchzuckt es heiß, und den Toni neben mir reisst es, als hätte er einen Stromschlag bekommen: Alt!
Alt, dünnstangig, hoch. Und bis auf Läufe und Stich verdeckt. Jetzt zieht er weiter, immer hinterm Buchenlaub. Wenn er so weitergeht, dann kommt er uns endgültig aus. Ich bleibe mit dem Absehen da, wo ich das Blatt vermute, aber es wird und wird nicht frei. Dafür wird der Toni neben mir aufgeregter und aufgeregter, deutlich kann ich sein Zittern spüren und selbst fällt es mir auch schwer, das Fadenkreuz ruhig zu halten. Ich öffne das rechte Auge, um mehr zu sehen von dem Wechsel, den der Bock eisern hält. Da ist eine Lücke im Laub, drunter sieht man den Hang, da muss es passen! Ich halte mitten hinein, auf die vermutete Höhe des Blattes. Bin sicher aufgelegt und völlig ruhig. Die Lücke wird rot, mit der Kugel auf dem Trägeransatz walgt der Bock herunter zu uns, bleibt im Farn liegen und verschlegelt.
Als hätte uns der Leutnant das Kommando „Sprung auf! Marsch! Marsch!“ gegeben, sind wir beide im gleichen Moment aufgesprungen und im Laufschritt zum Bock hingerannt. Ein Rarer wars, ein ganz Rarer: vier Finger über die Lauscher hinaus wachsen die Stangen aus dicken und schweren Rosen, massiv unten drin und immer dünner werdend nach oben. Links eine Gabel mit tiefer Rückvereckung, rechts ein kaum angedeutetes Augend, sonst nur ein langer, blanker Spieß. Die Stangen aber stehen nicht parallel: die rechte ist etwas hinter die linke versetzt, ein marschierend G’wichtl. Bis heute ist es das einzige solche an meinen Wänden geblieben.
*
Der Toni Rosmer ist ein großer Fuchsspezialist und derer von Malepart gab es auf der Adelegg grad genug. Nun ist es ein reines Rehwildrevier, und so war es nicht unbedingt notwendig, Reineke und Ermelyne scharf zu bejagen. Aber Toni hat trotzdem Winter für Winter eine ganze Menge auserlesen schöner Fuchsbälge auf dem Brett gehabt, denn darauf versteht er sich besonders gut. Bevor er im Dienst meines Vaters seinen Berufsjäger machte, hatte er das Handwerk des Präparators erlernt. Da nimmt es wenig Wunder, dass ein Balg, dessen er sich annimmt, später als feinstes Rauhwerk überm Treppengeländer hängt. Ich selbst aber habe der Fuchsjagerei nie viel abgewinnen können, und das hat mit einem ganz bestimmten Erlebnis zu tun.
Über mehrere Jahre hinweg war ein ungarischer Herr bei uns zu Gast auf Rehböcke, und im Gegenzug lud er meinen Vater jeden Herbst auf hohe Fasane nach Schottland ein. In einem Jahr hatte dieser Herr nun seine Frau mitgebracht, eine überaus nette und sehr elegante französische Dame. Und ich, der ich eigentlich vorhatte mich in irgendeinem Tobel zu verklüften um einen von den Alten und Verdrahten der Wildkammer zuzuführen, ich wurde beauftragt, Madame im Revier herumzufahren zu Zerstreuung und Amusement. Man kann sich vorstellen, dass ich alles, was an guter Erziehung in mir war, aufbieten musste, um mir meinen recht schmalen Willen dazu nicht anmerken zu lassen. Dass ich damals kaum ein zitierfähiges Wort Französisch sprach, kam noch dazu. Aber was soll’s, man ist ein treuer Sohn und tut, wie einem geheißen. Ich bat Madame also in mein flüchtig aufgeräumtes kleines Automobil und fuhr sie Tag für Tag im Revier herum.
Auf einer dieser Fahrten kamen wir an einem späten und recht warmen Nachmittag im späten Juni auf der Höhenstrasse des Reviers an eine Stelle, die Schneebauers Reune heißt. Der Schneebauer ist ein großer Einödhof am Fuße der Adelegg, und seine Reune, also sein Holzeinschlag lag eine gute Wegstunde zu Fuß den Tobel hinauf oben im Revier. Heute ist es nurmehr eine kleine Blöße oben auf dem Grat, über die die Forststrasse hinführt. Und auf ebendieser Strasse fuhren wir dahin. Man kommt aus einem Hochholz einen kleinen Stich herunter auf die Reune, und grade da, wo die Blöße anfängt, saß ein junger Fuchs in der Sonne auf dem Weg. Ich schaltete sofort den Motor ab, damit das Füchsle uns nicht bemerke. Das hatte aber auch die Welt um sich herum völlig vergessen und unterzog sich auf seinem Sonnenplatzl einer gründlichen Toilette, leckte sich die Branten, kratzte sich ausgiebig am Gehör, wandte sich dann pfleglich seiner Lunte zu, schnappte zwischendrin nach einem Schmetterling, der ihm aber nicht recht schmeckte und den er darob wieder ausspieh. Just in dem Moment sprang der Kühlerventilator meines Autos mit vernehmlichem Surren an. Den Fuchs riss es herum und auf die Läufe, so dass er graderwegs zu uns herschaute.
Mein Auto damals war knallrot von Farbe, und da das Wild diesen Ton nur als verschwommenes Grau sieht, nahm der Fuchs uns nicht wahr. Aber das Surren, das interessierte ihn doch sehr, und es war ganz deutlich eine Sache, die man noch nicht kannte, der es mithin auf den Grund zu gehen galt. Tritt vor Tritt schnürte der kleine Kerl auf uns zu, kam immer näher heran, und schließlich stand er so nah vor meinem Wagen, daß er durch die Kühlerhaube verdeckt war. Madame und ich wagten nicht zu atmen, nicht uns zu regen, saßen mit vor Spannung weit aufgerissenen Augen da und warteten, was jetzt geschehen würde. Ich nahm an, dass er das Auto umrunden und sich dann davon begeben würde, also schielte ich aus dem Augenwinkel ins Gras und auf einen Langholzpolder neben der Straße. In just dem Moment machte es „Plonk!“, und der rotzfreche Bengel war richtig auf meine Kühlerhaube gesprungen. Das sonnenwarme Blech unter seinen Branten schien ihm ganz besonders zu behagen, er setzte sich hin, wetzte zwei, dreimal mit dem Hinterteil hin und her, rollte sich dann ein und ratzte behaglich vor sich hin. Keinen halben Meter von uns entfernt hielt der junge Herr seine Siesta, und er war offenbar so fest eingedöst, dass er das atemlos gemurmelte „Que ravissant, que incroyablement ravissant!“ von Madame nicht vernahm. Aber wie es halt so ist: die Jugend döst zwar gern und oft, aber nicht lange. Wie lange der Fuchs auf meiner Kühlerhaube geschlafen haben mag – ich kann es beim besten Willen nicht sagen. In diesem Moment fand Zeit nicht statt.
Nach einer Weile begann sich der Welpe zu regen, blinzelte in die Sonne und erhob sich. Da dämmerte ihm dann, dass vier weit aufgerissene Augen auf ihn starrten. Aber er sprang immer noch nicht ab, sondern wollte nun erst recht wissen, was für komische Tiere das seien, die da saßen und ihn anglotzten. Er kam so nah heran, dass er mit seiner Nasenspitze gegen die Windschutzscheibe stieß, und das verstand er nun vollends nicht: da sitzen zwei komische Viecher, die man ganz genau sehen kann, aber dran kann man nicht, und riechen kann man sie auch nicht. Sehr seltsam!
Noch mehrmals stupste er gegen die Scheibe, dann ward es ihm endlich zu dumm, und mit einem Satz sprang er von der Kühlerhaube auf den Langholzpolder neben der Straße, linste noch einmal zum offenen Fahrerfenster herein und begab sich dann seiner Wege.
Wer sich jetzt noch wundert, warum ich seit dem Tag so recht keinen Fuchs mehr schießen mag, dem kann ich auch nicht helfen. Viel lieber schau ich mir den kleinen roten Wildhund an, wo immer ich ihn zu Gesicht bekomme. Und speziell in England scheinen die Herren von Malepart zu wissen, dass ihnen von mir keine Gefahr dräut: wann immer ich einen Gast führe und auf eine Wiese komme, sehe ich nur noch eine rote Lunte im Gebüsch verschwinden. Komme ich aber allein dahergezockelt, dann setzen sich die Füchse auf ihre Keulen, wir sehen uns an und wünschen uns einen Guten Tag. Und hat der Fuchs dann auch noch einen Fasan im Fang, einen der vielhundert oder -tausend, die auf dieser profesionellen Flugwildjagd jährlich ausgewildert werden, dann wünsche ich ihm im Stillen einen recht Guten Appetit dazu. So habe ich eine viel größere Freude damit, die Füchse zu beobachten und zu studieren, habe auch meine alten Bekannten, die ich Jahr um Jahr wiedersehe. Und zunehmend sehe ich das bestätigt, was britische Forscher vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass der Fuchs nämlich kein echter Einzelgänger ist, er vielmehr in einem fein justierten, aber großflächig angelegten Sozialgefüge, ja, Rudel lebt.
Das Erlebnis mit dem Fuchs auf der Kühlerhaube hat Madame übrigens ebenso wenig losgelassen wie mich. Und jedes Mal, wenn ich sie und ihren Mann in späteren Jahren wieder traf, war unweigerlich die erste Frage: „Rapellez-vous: le petit renard sur le capot?“
Dass ich übrigens mich in diesem Sommer jagdlich so brav zurückgehalten hatte, das hatte einen höchst lohnenden Effekt. Im Arbeitszimmer meines Vaters steht im Eck ein großer, behäbiger Kamin, und auf dessen Abzug hingen immer die besten Böcke des Revieres. Nur wenn einer zur Strecke kam, der besser war als alle anderen, dann wurde der schwächste Bock herunter genommen, um dem Stärkeren Platz zu machen. Und als im Jahr des Fuchses die Blattzeit vorbei war, befand mein Vater, dass ich im nächsten Jahr einen „Kaminbock“ schießen sollte.
Das war mir natürlich Ehr und Freude, allerdings mit einem kleinen Aber: die besten Böcke der Adelegg, das waren druchweg recht hohe und ausnehmend gut vereckte, aber halt völlig ebenmäßige und damit für mich leider etwas langweilige Sechser. Ich hatte mich auf die Rücksetzer, auf die Abnormen kapriziert, und so brauchte es etwas Suchen, bis ich meinen Kaminbock fand.
‚Der Fahrradlenker’, so geschehen am Ölbergwald, des Jahres MCMXCIII Juli den 24.
Begonnen aber schon im Mai des selbigen Jahres: ich hatte mich mit Toni zu einer Frühpirsch verabredet und war zum Huggerhof gefahren. Von der Frühpirsch ist nichts Rares zu berichten, dafür aber vom Heimweg: ich war keinen halben Kilometer gefahren, da stand linkerhand neben der Landstrasse ein Reh. Das Glas lag auf dem Beifahrersitz, und das, was ich dadurch sah war nicht hoch, aber sehr dick. Ich wurschtelte mein Spektiv aus dem Rucksack und machte den Motor aus, der Vibrationen wegen. Das war nun ein völlig sinnloses Unterfangen, denn dass, was ich mit der 30fachen Vergrößerung sah, sorgte bei mir für einen satten Tremor: da droben, wo der Ölbergwald den Rinnebühl hinaufgeht, stand ein kapitaler und abnormer Bock! Von den Skizzenkarten meiner Kindheit hatte ich immer einen Stoß im Handschuhfach, und ein Bleistiftstummel fand sich auch. Nach einer hastigen Zigarette war ich soweit wieder ruhig, dass ich das, was ich da sah, skizzieren konnte: ausnehmend starke, schlecht geperlte und seltsam kurvig gebogene Stangen bis knapp über Lauscherhöhe mit winzigen, aber daumendicken Augenden. Danach bogen die Stangen fast waagrecht und mehr als handbreit nach hinten weg, um dann mit kleinen Markierleisten noch einen Schwung nach oben zu machen. Das Geweih schaute sich an fast wie ein Fahrradlenker, und damit hatte der Bock auch seinen Namen weg.
Das ganze G’wichtl war massiv bis obenhin, und trotzdem war es, konnte es kein junger Bock sein: grau das Gesicht, hell die Muffel, kraus die Stirnlocke, Dachrosen tief in den Schädel hinein, und vom Stangenansatz zog sich ein breiter, weißer Streifen über die Lichter hin bis fast zum Windfang, so daß es beinah aussah, als hätte der Rehbock Zügel wie ein Gams. Dazu ein massiger Wildkörper, der Träger kurz und waagrecht, die ganze Figur des alten Bockes aus dem Lehrbuch. Nach gut einer Viertelstunde zog er gemächlich in den Wald und war weg.
Als ich meinen Eltern zuhause den Bock beschrieb, fragte mich meine Mutter am Frühstückstisch, ob ich an diesem Morgen gejagert oder doch eher gesoffen hätte. Ich schwor mehrere höchstheilige Eide auf meine Nüchternheit und flehte sie an, mir und meiner Skizze doch bitte zu glauben. Sie ließ sich alles noch einmal haarklein berichten und kam dann zu dem Schluss: „Nach allem, was Du beschreibst, ist das ein blutjunger Bock: G’wichtl massig bis obenhinauf, buntes Gesicht und überhaupt: wenn da tatsächlich ein alter Bock und dazu noch guter Bock keine fünfhundert Meter neben dem Haus vom Jager auf die Wiesen tritt, warum hat den dann noch keiner je gesehen?“
Ich argumentierte, diskutierte, explizierte – es half nichts: Der Bock müsse jung sein, wenn er überhaupt so gut sei, wie ich es beschrieben hatte. Wo ihn außer mir doch noch nie jemand gesehen hätte, und so ein guter Bock wäre doch jedem aufgefallen. Selbst meine Erklärung, daß über der Wiese neben der Straße zwei große Kahlflächen im Bestand seien, an die wegen der übrigen dichten Vegetation kein Herankommen sei, idealer Einstand für einen alten Bock mithin, darum sei er ein Ungesehener – auch das fruchtete nichts. Denn meine Mutter rief umgehend den Bauern vom Ölberghof an, hinter dessen Haus diese Flächen lagen, und auch der – obwohl mit allen wilden Wassern gewaschen – hatte den Bock nicht gesehen. Jung also. Oder ein Hirngespinst. Die Diskussion wurde so heiß, dass sie richtig in einen kleinen Streit ausartete und mein Vater mich beiseite nehmen musste: „Schau, man hat sich schnell einmal geirrt bei einem Bock, das ist uns allen schon passiert. Sie weiß halt soviel mehr über die Rehe als Du, also gib halt nach.“ Nein, und punktum. Ich hatte gesehen, was ich gesehen hatte: der Bock war alt, und dabei blieb ich.
Ein paar Tage darauf – ich war wieder im Badischen bei meinem Sender – rief meine Mutter an: sie habe gemeinsam mit dem Rosmer Toni den fraglichen Bock gesehen, an genau der bezeichneten Stelle. Nicht sehr lange, aber lang genug zum Ansprechen. Meine Skizze stimme im Wesentlichen, der Bock sei sehr anständig, aber nicht so kapital, wie ich ihn beschrieben hätte. Und überdies sei er – und da sei der Jager mit ihr einig – bestenfalls zwei Jahre alt. Mir fiel schier der Hörer aus der Hand! Nun habe ich aber von meinem Vater eine gewisse Beharrlichkeit, um nicht zu sagen: einen granitenen Schädel geerbt. Daher ließ ich mich auch durch dieses doppelte vernichtende Urteil nicht überzeugen, und selbst ein nachheriger Beschwichtigungsanruf vom Toni, der Stein und Bein schwor, dass es wirklich ein junges Böckle sei, änderte daran etwas. Ich nahm mir den Freitag unter fadenscheinigsten Vorwänden frei, verließ am Donnerstag unzüchtig früh das Büro und fuhr wieder ins Allgäu.
Für mein ungewohnt frühes Ankommen im Elternhaus setzte es gleich das nächste Donnerwetter. Jagerei hin, Bock her: es gäbe Pflichten, die vor der Jagd kämen, und wenn ich es tatsächlich zu Wege brächte, mich wegen eines blöden – und dazu noch jungen – Bockes aus der Arbeit zu schwindeln, dann hätte ich noch einiges zu lernen! Ich verschmollte mich zum Toni und mit ihm in den Wald. Der hat mich auf einen Hochstand gesetzt und mir eine längere Therapiepredigt gehalten, an deren Ende ich zum Schluss kam: das Bockthema schneiden wir für geraume Zeit nicht mehr an.
Der Mai ging zu Ende, der Juni war fast vorbei, und ich war wieder wochenends im Allgäu. An einem Abend hatte ich wieder einmal die Freud’ meine Mutter führen zu dürfen. Den Ölbergwald, die Heimat des „Fahrradlenkers“, hatte ich wohlweislich und weiträumig gemieden, und so hatte meine Mutter auf den Almwiesen am Herrenberg einen recht guten und alten Bock geschossen. Es war grad allerletztes Büchsenlicht, als wir den Rinnebühl herunter zum Huggerhof fuhren. Ich wollte gerade zum Haus abbiegen, da hielt mich meine Mutter am Arm fest und sagte: „Da steht Dein Bock!“ Für das Spektiv war es schon viel zu dunkel, also versuchte ich mit dem 10x40 etwas auszumachen. Viel Licht war es nicht mehr, und der Bock nicht genau zu kennen: er hatte wohl die Form des Fahrradlenkers, aber er war irgendwie, nun ja, anders halt. Sollte ich mich tatsächlich geirrt haben?
Als wir droben beim Huggerhof mit dem Toni den Bock meiner Mutter ausgeladen hatten und noch bei einem Glas vorm Haus saßen, hechelten wir die ganze Suada noch einmal kleinfein durch, wogen Argument gegen Argument, Beobachtung gegen Beobachtung. Es blieb beim gleichen Stand: Zwei für jung gegen Einen für alt. Ich hielt daran fest: insgesamt war der Bock dreimal gesehen worden. Einmal gerade eben bei schelchtem Licht, ein weiteres Mal nicht sonderlich lang von Mutter und Jager, ein drittes Mal von mir über eine Viertelstunde bei bestem Licht und mit dem Spektiv. „Vielleicht isch genau des es Problem“, sagte der Toni. Wenn man so lange und immer nur mit dem großen Glas ein Stückl Wild ansprechen wolle, dann wüchse das weit über die Realität hinaus: „Muesch halt immr amol s’Spektiv gegs es Fernglas wechlse!“ Daß ich darauf zu einem Widerwort ansetzte, ließ bei meiner Mutter endgültig das Kragenknöpfl sausen: „Jetzt pass einmal auf, du verbohrter Hornochs! Wir haben den Bock gesehen und sagen beide, dass er jung ist. Du selber hast ihn grade gesehen und bist Dir auch nimmer sicher gewesen. Wenn Du wirklich so unbelehrbar bist, dann schieß den blöden Bock halt zusammen! Vielleicht lernst Du was dabei!“
Nein, ich habe es daraufhin nicht Tag und Nacht auf den „Fahrradlenker“ probiert. So vorgeführt werden wollte ich dann doch nicht. Wenn der Bock fallen sollte, dann nur, wenn er halt grade da stand und ich vorbeikäme. Ich kam oft vorbei, aber der Bock stand nie da, und auch der Toni bekam ihn nicht zu sehen. Der Fahrradlenker geriet beinahe in Vergessenheit. Ende Juli hatte ich mir drei Wochen Urlaub genommen um im Bayrischen und in Österreich zu blatten. Da aber am ersten Samstag dieses Urlaubs ein guter Freund seinen Vierzigsten mit einem prachtvollen Fest feiern wollte, war ich zuerst ins Allgäu gefahren, der Freund wohnte nur eine gute Stunde von den Eltern weg. Einer meiner beiden Schwäger war ebenfalls im Allgäu, und so verabredeten wir uns für den Samstag zu einer Frühpirsch und fuhren noch im Stockdunklen zum Jager hinaus. Eigentlich wollten wir direkt hinter dem Hof durch den Wald auf die Almen steigen und uns dort umschauen. Aber als wir fertig adjustiert beim Toni hinterm Haus standen, sagte er: „Etz kommet, etz gugge nr no kurz auf d’Wiesa rab, vielleicht schtoht em Bertram sei Bock do.“ Und tatsächlich: auf der Wiese unterm Ölberwald leuchtete es rot.
Der Toni hatte das Glas als erstes oben, und kaum hatte er durchgeschaut, beutelte es ihn am ganzen Körper: „Schnell schieße, des isch der Guete!“ Ich wollte meinem Schwager den Vortritt lassen, aber der lehnte ab, und da hab’ ich dann auch keine Widerrede mehr geleistet. Den Bock haute es im Schuss ins Gras, ein kurzes Schlegeln noch, dann war es aus. Hätte ich im Schulsport ähnliche Sprintleistungen gezeigt wie damals, als ich mit Riesensätzen die Wiese zum Bock hinaufgerast bin, hätten meine Noten im Fach „Leibesübungen“ besser ausgesehen. Ich wollte es jetzt wissen, wollte als erster am Wild sein, wollte als erster Sicherheit haben über Bestätigung oder Blamage. Keuchend kam ich beim Bock an: das Haupt lag Unterkiefer nach oben im Gras, das G’wichtl hatte sich in den Wiesenboden gegraben. Zitternd zog ich es heraus, wischte es sauber, betastete es: Dachrosen, dicke Stangen, die Perlung wie mit Sandpapier angeschliffen, daumendicke Augenden, waagrechter Knick auf Handbreite. Schob einen Finger in den Äser, fühlte nach und ließ dann ein wildes Siegesgebrüll heraus: Alt! Abnorm! Kapital!
Mein „Fahrradlenker“!!! Als mein Schwager und der Toni bei mir oben ankamen, hielt ich ihnen triumphierend das Haupt samt Bock daran entgegen. Mein Schwager grinste breit und wissend, der Toni aber schob den Hut ins Genick, kratzte sich am Kopf und sagte dann nur: „Sakrament. Hosch doch recht ghet!“
An eine Frühpirsch war nicht mehr zu denken. Umgehend war der Bock aufgebrochen und eingeladen, und im Triumphzug machten wir uns auf zum Elternhaus. Der Weg dorthin führte am Haus meines Schwagers vorbei, und er befand, dass es um halber Siebene in der Früh noch nicht statthaft sei, solcherart vor den Eltern zu protzen und zu prahlen. Wir machten Station bei ihm. Die Leber des Bockes lag mit reichlich Kümmel im brutzelnden Butterschmalz, die Nieren schwammen in einer dickrahmigen Senfsauce, und die Magnum eines alten Bordeaux aus Schwagers Keller rundete das Jagdfrühstück so wunderbar ab, dass wir erst gegen halb Zehn mit Blitzräuschen im Schädel bei den Eltern vorfuhren.
Meine Mutter stand reichlich konsterniert vor dem gestreckten Bock, umrundete ihn mehrfach kopfschüttelnd und sagte nur immer wieder: „Gibt’s doch nicht!“ Mein Vater stand grinsend daneben und freute sich mit mir an meinem dreifachen Triumph: ich hatte einen abnormen Kaminbock geschossen, ich hatte ihn richtig angesprochen, ich hatte mich nicht irre machen lassen. Von Wein, Bock und Morgen berauscht konnte ich es mir nicht verkneifen meine Mutter, während ich einen ganzen Film auf den Bock verknipste, zu fragen: „Wer hat jetzt was gelernt?“
Ihr „Du Frechdachs!“ kam nur noch halbernst heraus, und dann war’s ein breites Lachen! Mein Vater hat den Bock, als er ein paar Tage später ausgekocht war, eigenhändig auf den Kaminsims gestellt, dort steht er heute noch und dort lass ich ihn stehen, solange mein Vater lebt.
Ein kleines Nachspiel gab es aber noch zum „Fahrradlenker“, und das fand im späten Herbst des beschriebenen Jahres statt. In Baden-Baden erreichte mich ein Anruf aus dem Sekretariat meines Vaters: meine Mutter wünsche mich dringlichst am Samstag im Allgäu zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, worum es sich handelte, setzte mich aber brav am Samstag ins Auto und fuhr nach Hause. Als mein Wagen auf den Kies vor der Haustür rollte, stand meine Mutter schon mit einem diebischen Grinsen im Gesicht auf den Stufen und winkte mich mit dem Finger zu ihr her. Dann langte sie wortlos in die Jackentasche und drückte mir zwei Abwurfstangen in die Hand. Dem Petschaft nach waren es die Stangen eines recht jungen Bockes. Kranzrosen, starke Perlung, daumendicke Augenden, dahinter waagrechter Knick auf Handbreite und kleiner Schwung nach oben! Am Ölberg hatte es also tatsächlich zwei „Fahrradlenker“ gegeben: den Alten, den ich zuerst gesehen und zuletzt erlegt hatte, und seinen offensichtlichen Sohn! Der war es, den meine Mutter und der Jager gesehen hatten, den hatten vermutlich auch meine Mutter und ich im schlechten Licht am späten Abend gesehen.
Unter dem Haupt des alten „Fahrradlenkers“ auf dem Kaminsims im Arbeitszimmer meines Vaters liegen nun diese beiden Abwurfstangen und die Skizze, die ich damals im Auto angefertigt hatte und erzählen diese Geschichte hier. Bei mir zu Hause liegt schon ein Schild bereit, der irgendwann einmal G’wichtl, Stangen und Skizze aufnehmen wird, dann, wenn mein Vater nicht mehr lebt. Gott geb’, dass dieser Schild noch lange freibleibt.